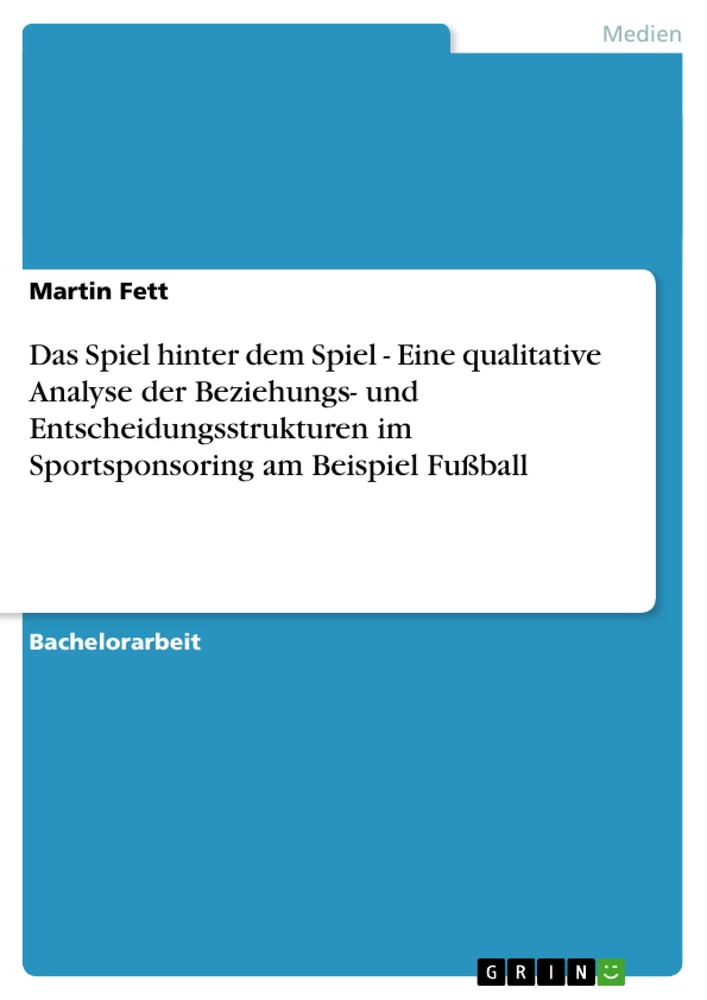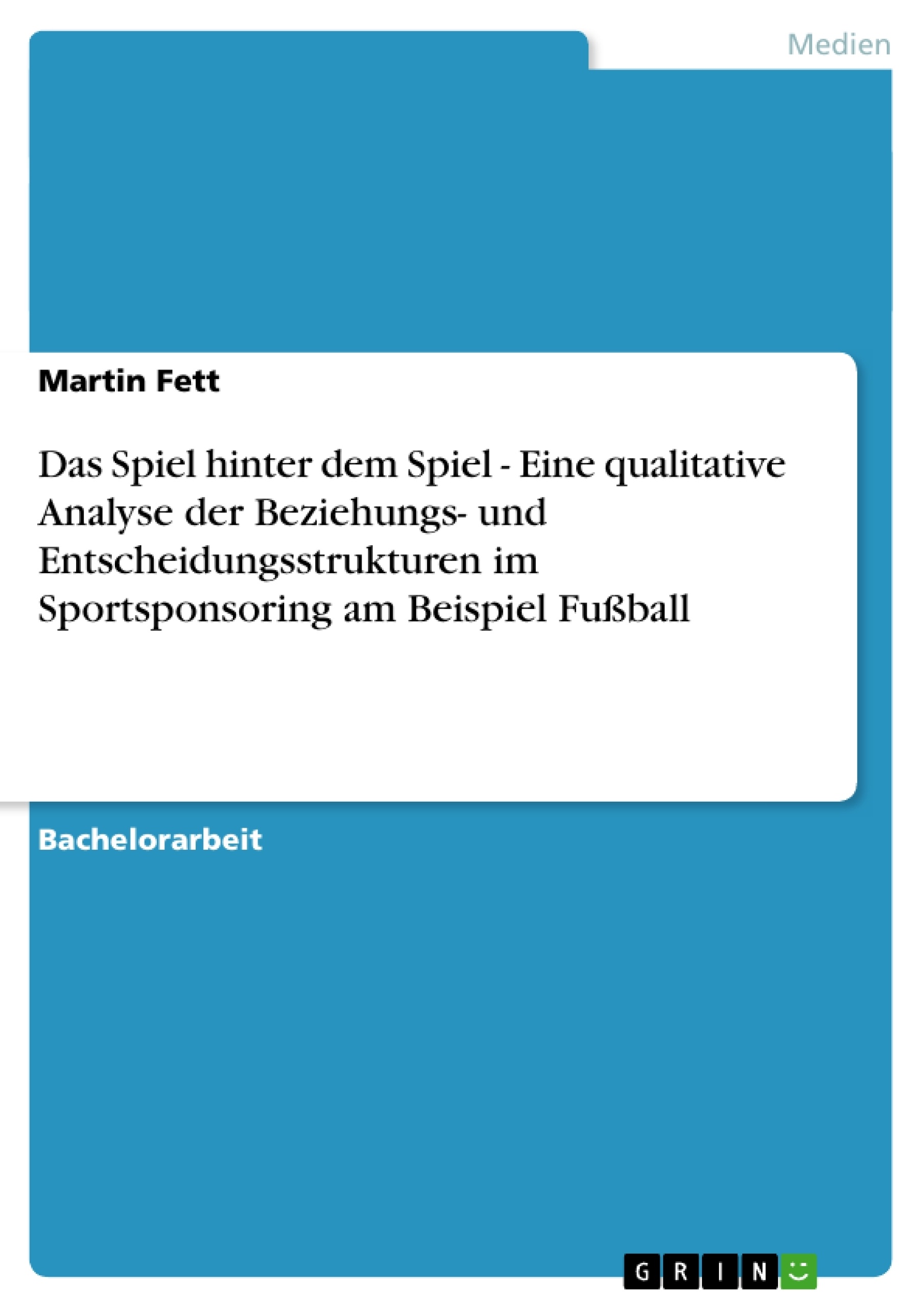Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Beziehungs- und Entscheidungsstrukturen im Sportsponsoring am Beispiel Fußball und betrachtet im speziellen die Machtbalance zwischen dem Bundesliga- Verein BB und dem sponsernden Unternehmen DD.
Ziel der Arbeit war die Etablierung eines Modells, das induktiv am Beispiel der analysierten Beziehungsgeflechte erstellt wurde. Mit dem theoretischen Fundament aus Organisationstheorie, mathematischer Spieltheorie, präskriptiver Entscheidungstheorie sowie weiteren Überlegungen aus dem Bereich der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics) und der Systemtheorie wird sich diesem Ziel schrittweise angenähert.
Leitfadengeführte qualitative Experteninterviews mit Verantwortlichen von Verein und Unternehmen ergeben zusammen mit den theoretischen Vorbetrachtungen ein sinnvolles Fundament, um ein Modell im Sinne einer Prinzipal-Agent-Beziehung aufzustellen. Das Modell dient damit als Grundlage weiterer Forschung im Bereich der Beziehungsstrukturen im Sportsponsoring am Beispiel Fußball. Berücksichtigt wurden hier vor allem die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse darüber, von wem die Sponsoringkooperation initiiert wird.
Üblich ist in der heutigen Zeit eine Akquise, die vom Verein ausgeht. Und obzwar eine größere Machtexistenz zu Beginn der Sponsoringvertragsverhandlungen auf Seiten der sponsernden Unternehmen beobachtet werden kann, gestaltet sich eine Partnerschaft in der Regel als sehr ausgeglichen.
Wesentliche Aspekte einer gesunden Zusammenarbeit sind hier neben Vertrauen und Zuverlässigkeit insbesondere auch eine persönliche Atmosphäre und ein reger Ideenaustausch in der Phase der Kooperation, die in aller Regel auf
zwei Jahre angelegt ist.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Sponsoring im Sport - „A match made in heaven"
2 Ziel der Arbeit
3 Forschungsfrage
3.1 Erste Dimension - Sportsponsoring
3.2 Zweite Dimension - Beziehungsstrukturen
3.3 Dritte Dimension - Entscheidungsstrukturen
3.4 Vierte Dimension - Fußball
3.5 Fünfte Dimension - Analyse und Erklärung
4 Theoretische Grundlagen
4.1 Organisationstheorie & Neue Institutionenökonomik
4.2 Systemtheorie
4.2.1 Spezifikation von Systemgrenzen
4.2.2 Menschenbild
4.3 Elias’sche Figurationssoziologie
4.3.1 Menschenbild
4.3.2 Macht und Machtbalancen
4.4 Die klassische Erwartungsnutzentheorie
4.4.1 Kritik am Homo Oeconomicus
4.4.2 Neue Erwartungstheorie
4.5 Verhaltensökonomik: Der Schlüssel zur Realität
4.6 Entscheidungstheorie als Grundlage der Spieltheorie
4.6.1 Entscheidungsregeln
4.6.2 Entscheidungen unter Risiko
4.7 Interdependente Entscheidungen: Spieltheorie
4.7.1 Der Vergleich zur präskriptiven Entscheidungstheorie
4.7.2 Stärken und Schwächen
5 Grundlagen des Sponsoring
5.1 Zum Begriff des Sponsoring
5.2 Sponsornehmer
5.3 Sponsorgeber
5.4 Dimensionierung der Sponsoringobjektsuche
5.5 Sponsoring in der Kommunikationspolitik
5.6 Ziele und Vorteile des Sponsorings für Sponsoren
5.7 Risiken des Sportsponsoring
5.8 Exkurs: Paradigma des Sportsponsoring
6 Methodisches Vorgehen
6.1 Forschungsdesign
6.2 Datenerhebung und -auswertung
7 Ergebnisse
7.1 Sponsornehmer
7.1.1 Relevante Spieler
7.1.2 Stellenwert des Sponsoring
7.1.3 Sponsorenstruktur
7.1.4 Kommunikation und Kooperation: Akquise
7.1.5 Kommunikation und Kooperation: Informationsaustausch
7.1.6 Kommunikation und Kooperation: Die strukturelle Beziehung aus Vereinssicht
7.1.7 Kommunikation und Kooperation: Vertragsinhalte
7.2 Sponsorgeber
7.2.1 Relevante Spieler
7.2.2 Stellenwert des Sponsoring
7.2.3 Sponsoring-Engagement
7.2.4 Kommunikation und Kooperation: Die strukturelle Beziehung
aus Unternehmenssicht
7.2.5 Ziele und Vorteile des Sponsoring-Engagements
8 Modell
8.1 Das Prinzipal-Agent-Modell
8.2 Anwendung auf das Sponsoring im Fußball
9 Fazit und Ausblick
Quellenverzeichnis
Zusammenfassung
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Beziehungs- und Entscheidungsstrukturen im Sportsponsoring am Beispiel Fußball und betrachtet im speziellen die Machtbalance zwischen dem BundesligaVerein BB und dem sponsernden Unternehmen DD. Ziel der Arbeit war die Etablierung eines Modells, das induktiv am Beispiel der analysierten Beziehungsgeflechte erstellt wurde. Mit dem theoretischen Fundament aus Organisationstheorie, mathematischer Spieltheorie, präskriptiver Entscheidungstheorie sowie weiteren Überlegungen aus dem Bereich der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics) und der Systemtheorie wird sich diesem Ziel schrittweise angenähert. Leitfadengeführte qualitative Experteninterviews mit Verantwortlichen von Verein und Unternehmen ergeben zusammen mit den theoretischen Vorbetrachtungen ein sinnvolles Fundament, um ein Modell im Sinne einer Prinzipal-AgentBeziehung aufzustellen. Das Modell dient damit als Grundlage weiterer Forschung im Bereich der Beziehungsstrukturen im Sportsponsoring am Beispiel Fußball. Berücksichtigt wurden hier vor allem die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse darüber, von wem die Sponsoringkooperation initiiert wird. Üblich ist in der heutigen Zeit eine Akquise, die vom Verein ausgeht. Und obzwar eine größere Machtexistenz zu Beginn der Sponsoringvertragsverhandlungen auf Seiten der sponsernden Unternehmen beobachtet werden kann, gestaltet sich eine Partnerschaft in der Regel als sehr ausgeglichen. Wesentliche Aspekte einer gesunden Zusammenarbeit sind hier neben Vertrauen und Zuverlässigkeit insbesondere auch eine persönliche Atmosphäre und ein reger Ideenaustausch in der Phase der Kooperation, die in aller Regel auf zwei Jahre angelegt ist.
Abstract
The bachelor thesis at hand deals with the structures of relations and decisions in the economic field of Sponsorship in Football and focuses on the balance of power between BB, a football club of the German FußballBundesliga, and its sponsor DD GmbH.
The aim of this paper was to design a theoretical construct, a model, that was established by induction on the basis of the analyzed networks.
On the theoretical framework of Organizational Studies, Game and Decision Theory, and further considerations from the fields of Behavioral Economics and Systems Theory this aim has been accomplished gradually.
For this purpose qualitative expert interviews were conducted with persons in charge of club and company, which were the basis to set up a model in terms of a Principal-Agent-Relationship. This theoretical model is considered to be a basis for further research in that field.
Particularly the conclusion who initiates the cooperation was taken into account. In these days the football club is responsible for a proper acquisition of sponsors. Even though there is a bigger existence of power in the beginning of the negotiations of a sponsoring contract on the company’s side, the bilateral partnership is balanced throughout the following process of sponsorship. Essential attributes of a proper cooperation, which is usually established for two years, are a personal atmosphere and a vibrant exchange of ideas, apart from trustworthiness.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Dimensionierung der Forschungsfrage
Abb. 2: Systembildung auf drei Ebenen
Abb. 3: Der Sponsoringprozess
Abb. 4: Die Überbelebung von Gesponserten im Fußball
Abb. 5: Das Paradigma des Sportsponsorings
Abb. 6: Die Hauptfinanzierungsquellen eines Bundesligisten
Abb. 7: Grundidee der Prinzipal-Agent-Theorie
Abb. 8: Spielbaum der Beziehungsstrukturen im Sportsponsoring
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Heute, mehr als jemals zuvor, ist der Werbemarkt in Deutschland durch intensiven Wettbewerb geprägt. Jährlich steigt die Zahl der Marken, Medien und Werbeimpulse, die um die Aufmerksamkeit der Konsumenten buhlen (vgl. Gölz 2006: 76). Während die weltweite Finanzkrise 2008 Auswirkungen auf fast jede Industrie und Region hatte, blieben laut Nielsen Global AdView Pulse (2009) die globalen Werbemärkte insgesamt stabil (vgl. Trost 2009). Auch wenn klassische Werbung in der Umsetzung kommunikationspolitischer Strategien unverzichtbar erscheint, haben die medialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen die Anforderungen an die Werbung und die Kommunikationspolitik im Allgemeinen drastisch verschärft. Steigende Informationsüberlastung, liberaler Welthandel und internationaler Wettbewerbsdruck, austauschbare Waren auf gesättigten Märkten, desinteressierte Konsumenten, fragmentierte Zielgruppen und ein gesellschaftlicher Wertewandel stellen Unternehmen zunehmend vor eine große Herausforderung (vgl. Bihn 2006).
Der Rezipient/die Rezipientin[1] einer Werbebotschaft wird durch diese Vielzahl an Informationen, die mittels klassischer Kommunikationsinstrumente verbreitet werden, überlastet und kann nur noch einen Bruchteil davon bewusst wahrnehmen - oder wollen (vgl. Venter et al. 2005: 11). Die mangelnde Bereitschaft, sich den Kommunikationsbotschaften zu widmen, äußert sich schließlich im Überblättern von Werbeanzeigen oder im Weiterschalten bei Werbung in Radio und Fernsehen (vgl. ebd.). Die klassischen Kommunikationsinstrumente verlieren also zunehmend an Ausstrahlung und Durchschlagskraft (vgl. Damm-Volk 2002: 73f.).
Auch durch sich angleichende Produktmerkmale (vgl. Philipp 1997) sind Unternehmen heute mehr denn je gezwungen, in einen starken Kommunikationswettbewerb zur besseren Markenpositionierung zu treten und greifen daher vermehrt auf nicht-klassische Kommunikationsinstrumente zurück (vgl. Bruhn 2007: 200f.; Esch 2005: 31ff.).
Sponsoring im Sport - „A match made in heaven“ Produktinformationen an sich sind nach Philipp (1997) zwar immer noch wichtiger Bestandteil der Marketingkommunikation, aber das Image eines Unternehmens und das Umfeld, in dem es sich bewegt, spielen seit den 1990er Jahren eine immer größere Rolle (vgl. Philipp 1997: 42f.; Bruhn 2007: 200). „Wir haben es heute mit einem Verbraucher zu tun, der [sich] verstärkt [...] für das soziale Engagement des Unternehmens interessiert" (Philipp 1997: 42f.).
Diese Feststellung wird durch die „Zauberformel" (Nufer/Bühler 2008: 386) von D’Alessandro (1993) ergänzt, die für Unternehmen interessant wird, auf der Suche nach attraktiven Veranstaltungen, die auf die Öffentlichkeit eine große Anziehungskraft ausüben: „Consumers love events, corporations love consumers - this is a match made in heaven" (D’Alessandro 1993: 507).
Bereits seit den 1980er Jahren gewinnt das Sponsoring im Sport zunehmend an Bedeutung. Es hat mittlerweile nicht nur einen festen Platz in der Unternehmenskommunikation gefunden, sondern gehört dort „seit Jahren konstant zu den Gewinnern" (Hermanns 2002).
Rund drei Viertel der 2500 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland nutzen das Sponsoring als Instrument in ihrem Kommunikations-Mix (Hermanns 2008a: 8). Auch die Mehrheit der Bevölkerung ist dem Sponsoring gegenüber positiv gestimmt: 74 Prozent der 14- bis 69-jährigen Deutschen bewerten Sponsoring als gut (vgl. Sportfive 2003: 18f.). Sogar 70 Prozent derjenigen, die der TV- und Printwerbung mit ihren eindeutig kommerziellen Zielen grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, beurteilen das Sponsoring positiv (vgl. ebd.). Denn dieses erweckt eher den Eindruck der Gemeinnützigkeit (vgl. Müller/Gelbrich 2004: 685). Die Hälfte der sportinteressierten Deutschen finden Marken besonders ansprechend, die im Sponsoring aktiv sind, 29 Prozent würden zudem eher das Produkt eines Sponsors erwerben, als das eines vergleichbaren Nicht-Sponsors (vgl. Sportfive 2002: 142).
Einerseits wächst die Bedeutung des Sponsoring als strategisches Marketinginstrument kontinuierlich, andererseits steigen die Investitionssummen für attraktive Sponsorships weiter an[2].
Das Gesamt-Sponsoring-Volumen wird Prognosen zufolge auch in Zukunft stetig wachsen (vgl. Taubken 2008: 6). Dabei werden die Ausgaben für Sponsoring im Sport[3] nach wie vor weit über die Hälfte des Gesamtvolumens für Sponsoring ausmachen (vgl. ebd.).
Das wirtschaftliche Engagement im Sport ist also aktueller denn je - doch wer profitiert davon in welchem Maße, wie sind die Beziehungsstrukturen zwischen Sponsorgeber und -nehmer ausgestaltet und was kennzeichnet deren Kooperation im speziellen?
Von der Sponsoringforschung bisher weitestgehend vernachlässigt ist eben diese Frage nach gegenseitigen Abhängigkeiten und interdependen- ten Strukturbeziehungen innerhalb des Systems Sportsponsoring. Diese strukturelle Figuration[4] steht im zentralen Fokus dieser Arbeit und wird mithilfe leitfadengeführter Experteninterviews umfassend abgebildet.
2 Ziel der Arbeit
Ziel der Arbeit ist es also, mittels qualitativer Leitfadeninterviews ein Modell zu entwickeln, das die Beziehungsstrukturen des Sportsponsorings am Beispiel Fußball veranschaulicht und analysiert. Bisher wurde in der sponsoringspezifischen Fachliteratur ein solches spiel- und systemtheoretisches Modell noch nicht entwickelt[5] - daher soll dessen Erstellung Ziel und Ergebnis der hiesigen Arbeit sein.
3 Forschungsfrage
Grundlage der vorliegenden Arbeit ist folgende Forschungsfrage:
Welche Beziehungs- und Entscheidungsstrukturen können im Bereich des Sportsponsoring am Beispiel Fußball identifiziert werden und wodurch lassen sich diese Strukturen erklären?
Aus der vorgestellten Forschungsfrage lassen sich Dimensionen ableiten, die im weiteren Verlauf analysiert werden sollen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Dimensionierung der Forschungsfrage
3.1 Erste Dimension - Sportsponsoring
Wie näher in Kapitel 5 erläutert, ist das Sponsoring im Sport und hier in der Sportart Fußball das populärste unter den Sponsoringtypen und steht in der Arbeit daher im Mittelpunkt.
Bei dem Marketinginstrument des Sponsoring handelt es sich um eine nicht-klassische-Marketingmaßnahme, die von Bruhn (2005) als Geben („Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-How") und Nehmen („Ziele des Unternehmens [...] erreichen") definiert wird[6] (Bruhn 2005: 811).
In der Saison 2009/2010 spült die Werbung am Mann, die Trikotwerbung, den Bundesligavereinen über 130 Mio. Euro in die Kassen - soviel wie noch niemals zuvor[7]. Dabei variieren die jeweiligen Summen erheblich: Sind der FC Bayern München, FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg mit je 20 Mio. Euro Branchen-Krösus, findet sich u. a. die TSG 1899 Hoffen- heim mit 3 Mio. Euro abgeschlagen am Ende wieder. Gemessen am Aufsehen, das der baden-württembergische Emporkömmling bereits in seiner Premierensaison verursachte, ein wahres Schnäppchen (vgl. o. A. 2009b).
3.2 Zweite Dimension - Beziehungsstrukturen
Sponsoring stellt neben den Einnahmen aus TV-Rechten, Eintrittskartenverkauf und Merchandising eine Hauptfinanzierungsquelle professioneller Fußballvereine dar (vgl. Bühler 2004: 1). Die vorliegende Arbeit analysiert und beschreibt in der Zweiten Dimension der Forschungsfrage die allgemeine Sponsorenstruktur und Präsentationsform der kommerziellen Partner eines Vereins. Insbesondere deren Beziehungen zu den Sponsornehmern, den Vereinen, werden genauer betrachtet. Von Relevanz ist dazu Wertschätzung und Stellenwert, die das Instrument des Sponsorings sowohl im gesponserten Verein als auch im Unternehmen genießt.
3.3 Dritte Dimension - Entscheidungsstrukturen
In der vorliegenden Arbeit werden faktisch beobachtbare Entscheidungsprozesse in den Organisationen Unternehmen und Verein analysiert. Ein besonderes Augenmerk gilt der Frage, wie organisatorische Merkmale, also wirtschaftlicher bzw. sportlicher Erfolg, begrenzte Ressourcen und sonstige Variablen auf Entscheidungen wie beispielsweise die unternehmensspezifische Sponsoringobjektsuche (vgl. Kapitel 5.4) einwirken können. Entscheidungen sollen hier nicht als punktuelle Handlung begriffen werden, sondern als ein Prozess, der bestimmte Phasen durchläuft.
3.4 Vierte Dimension - Fußball
Das generelle Sportinteresse der Deutschen ist mit 91 Prozent europaweit an der Spitze (vgl. Sportfive 2002: 10). Auch wenn die Mitgliederzahl in Vereinen rückläufig ist (vgl. Reul 2008), ist der passive Sportkonsum davon weitestgehend nicht betroffen. Motive dafür sind besonders vielfältig. So sorgt die Unvorhersehbarkeit der sportlichen Ereignisse für ein großes Maß an Spannung und durch eine Identifikation mit Verein oder Sportler kann der passive Sport-Konsument aktiv an den Erfolgen teilhaben. Auch das Gemeinschaftserlebnis und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte vor Ort sollten hierbei nicht außer Acht gelassen werden.
Über zwei Drittel aller Deutschen zeigen für den Fußballsport großes Interesse (vgl. Sportfive 2003: 38). Unabhängig von Alter, sozio- ökonomischem Status und Geschlecht spricht der Fußball ein besonders breites Publikum an (vgl. ebd.). Diese Faktoren können der Entscheidung von Unternehmen, sich mit den populären Instrumenten des Sponsorings im Fußball zu engagieren, durchaus förderlich sein.
Der Fußballsport eignet sich in herausragendem Maße zur Betrachtung wirtschaftlicher Beziehungsgeflechte. Nach Rittner/Mrazek (1989) gilt dieser als sehr leistungsorientiert und sehr spannend (vgl. Rittner/Mrazek 1989: 82). Dabei wird er als „gar nicht exklusiv und gar nicht elegant" beurteilt (ebd.). Diese Grundlagen der sportartspezifischen Wahrnehmung sind offensichtlich von weitreichender Bedeutung, wenn es zum Sponsoring im Fußball kommt. Wie sehen die Beziehungsgeflechte bei dem emotional induzierten Wirtschaftsgegenstand Fußball aus? Inwiefern greift hier der Ansatz der Verhaltensökonomik und die Theorie der Entscheidungen unter Risiko bzw. Unsicherheit?
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird mit 1899 Hoffenheim ein professionell geführter Verein des Fußball-Spitzensports betrachtet. Aus diesem Grund werden hierzu Verantwortliche auf Sponsoren- sowie Vereinsseite befragt.
3.5 Fünfte Dimension - Analyse und Erklärung
Den Abschluss bei Beantwortung der Forschungsfrage bilden Analyse und Erklärung der vorher durch Experteninterviews erlangten Ergebnisse. Mittels der empirischen Erhebung werden die Beziehungen des Sportsponsorings im Fußball in Form eines Modells aufgezeigt und analysiert.
4 Theoretische Grundlagen
Zur umfassenden Bearbeitung der Forschungsfrage sollen die Ansätze der Organisationstheorie in Verbindung mit den Grundlagen der Verhaltensökonomik und der mathematischen Spieltheorie, sowie Erkenntnissen der Elias’schen Figurationssoziologie miteinander verknüpft werden. Auch Akteurskonstellationen der Systemtheorie sollen als theoretisches Fundament dienen und helfen, ein Modell zu konzipieren, welches die Beziehungsstrukturen in diesem Bereich optimal darstellt.
Die Analyse ist dem Methodologischen Individualismus[8] verpflichtet, nach dem kollektive Phänomene vom Handeln der einzelnen daran beteiligten Personen aus beschrieben werden.
4.1 Organisationstheorie & Neue Institutionenökonomik
Fasst man die zahlreichen Definitionen, die zum Terminus der Organisation existieren, zusammen, so gelangt man zu folgender, für den Forschungsgegenstand relevanten Begriffsbestimmung:
Eine Organisation gilt als „Ordnungsrahmen für das betriebliche Geschehen" (REFA 1993) und kann als psychosoziales, zielorientiertes Sozialsystem charakterisiert werden, welches Informationen gewinnt und verarbeitet (vgl. Kast/Rosenzweig 1970). Darüber hinaus gelten eine spezifische Zweckorientierung [...] und eine Beständigkeit jeglicher Art als zentrale Elemente des Organisationsbegriffs (vgl. Schreyögg 2008: 9).
Auch im Rahmen der Organisationstheorie sind Erkenntnisse der Entscheidungstheorie wesentlich, denn so bestehen Organisation, Management und Unternehmensführung insbesondere aus der Wahl von Entscheidungsalternativen (vgl. Wolf 2008: 126).
Indem anders als in der üblichen neoklassischen Ökonomik die Trennung von Entscheidungs- und Organisationstheorie dadurch aufgehoben wird, dass die Hypothese der Nutzenmaximierung auf jegliche individuellen Wahlhandlungen ausgedehnt wird, erweitert der Neue Institutionalismus den Anwendungsbereich der neoklassischen Theorie (vgl. Rich- ter/Furubotn 2003: 2f.). Ein Entscheidungsträger trifft seine eigenen Entscheidungen und verfolgt dabei seine Interessen in den Grenzen, die ihm von der Struktur der Organisation, in denen er handelt, gesetzt sind (vgl. ebd.). Ziel der Neuen Institutionenökonomik ist die Erklärung der Erscheinungsformen und Auswirkungen von Institutionen[9] und Organisationen (vgl. Lobigs 2004: 52).
Barnard[10] (1971) macht (ebenso wie die systemtheoretischen Überlegungen nach Luhmann, vgl. Kapitel 4.2) allerdings Handlungen zum Wesensbestandteil von Organisationen (vgl. Barnard 1971: 65). Daher sind die Grenzen zwischen „Innen-" und „Außenwelt" nicht mehr so einfach zu ziehen. Organisation wird nach den Vorstellungen Barnards also als Koalition aller kooperierenden Spieler verstanden; alle Kooperationsbeteiligten werden zu Teilnehmern der Organisation (vgl. Schreyögg 2008: 46).
Daraus ergibt sich, dass das organisatorische Verständnis die Gesamtheit der Anspruchsgruppen („Stakeholder") einbeziehen muss. Die Organisation wird daher als „Koalition von Individuen und Gruppen" begriffen (vgl. Schreyögg 2008: 46).
4.2 Systemtheorie
Fast jeder verfügt über gewisse Vorstellungen, wenn er mit dem Begriff des Systems konfrontiert wird, da dieser mittlerweile in den alltagssprachlichen Gebrauch fest integriert ist. Dennoch ist es notwendig, eine prägnante Charakterisierung für den Systembegriff zu finden. In der neueren Systemtheorie versteht von Bertalanffy (1972) unter dem Begriff des Systems „eine Menge von Elementen, zwischen denen Beziehungen bestehen oder hergestellt werden können" (von Bertalanffy 1972: 31ff.), also etwas eher abstraktes. Im Folgenden wird nun der unscharfe Terminus des Systems anhand einer Reihe von Merkmalen charakterisiert.
Systeme bestehen als „organisierte Entität" (Mencke 2005: 56) aus Elementen mit bestimmten Eigenschaften. Diese wiederum sind elementspezifisch und einzigartig; eine Abgrenzung zu anderen Systemen kann somit relativ einfach vollzogen werden (vgl. Wolf 2008: 158). Beim System „Fußballverein" stellen beispielsweise die einzelnen Mitarbeiter und Mannschaften, sowie deren Fußballspieler, die Abteilungen und Funktionsbereiche, die Mitglieder und sonstigen Fans derartige Elemente dar.
Innerhalb eines solchen Systems existiert eine hierarchische Gliederung der Elemente (vgl. Wolf 2008: 158). Viele von ihnen liegen auf derselben Ebene, nicht alle befinden sich in einem unter- bzw. übergeordneten Verhältnis zu anderen Elementen.
Systeme bestehen daraus, dass sie gar nach einem Innen und Außen differenziert werden können (vgl. Luhmann 1999). Systeme tauschen mit ihrer Umwelt materielle und immaterielle Ressourcen rege aus (vgl. Wolf 2008: 161f.). Nach Wolf (2008) ermöglicht dieser intensive Ressourcenaustausch der offenen Systeme erst die Ordnung und Lebensfähigkeit von diesen (vgl. Wolf 2008: 164). Bezogen auf das Beispiel des professionell organisierten Fußballvereins halten materielle Ressourcen der Sponsoren diesen am Leben und damit in sportlicher Wettbewerbsfähigkeit. Zur Offenheit von Systemen gehört des Weiteren, dass die systemeigenen Handlungen anhand eines gesamten Zielbündels ausgerichtet sind (vgl. Wolf 2008: 164). So richtet das Sozialsystem „Fußballverein" seine Aktionen nicht nur an den sportlichen Zielen der Mannschaftsverantwortlichen, sondern daneben auch an politischen und ökonomischen Zielen anderer Interessensgruppen aus (vgl. Antes/Siebenhüner 2001; Haase 2006).
Professionelle Fußballvereine sollen in der vorliegenden Arbeit durchaus als solche offene Systeme angesehen werden, denn so kann beispielsweise das Hinzukommen oder Ausscheiden eines bestimmten Mitarbeiters oder sonstigen Akteurs (Fußballspieler) eine grundlegende Veränderung der Verhaltensweise der betroffenen Sub-Systeme bewirken oder gar Einfluss auf die Beziehungen in der Umwelt des Systems „Fußballverein" nehmen. Als besonders prominentes Beispiel kann hier die Rückkehr des Nationalspielers und Kölner Eigengewächses Lukas Podolski vom FC Bayern München zum 1. FC Köln angeführt werden. Er wird vielerorts als „Heilsbringer“ (Matz/Weng 2009) verehrt; mit ihm sind im Verein und auch in der Region vielerlei Hoffnungen auf sportlichen und auch wirtschaftlichen Erfolg verbunden. Schnell wird also deutlich, dass ein einziger Spieler auch die Beziehungen im Umfeld beeinflussen kann: So haben sogar der Kölner Hauptsponsor und einige weitere regionale Unternehmen den Verein bei der Rückholaktion finanziell unterstützt (vgl. Strohschein 2009).
Auch wenn Systeme nicht als monolithischer Block angesehen werden sollten, existiert in diesen dennoch eine gewisse fixe Ordnung, die das Beziehungsgefüge zwischen Elementen und Subsystemen eines Systems als Systemstruktur erscheinen lässt. Im Hinblick auf einen Fußballverein ist diese stabile Struktur offensichtlich: So wechselt nicht jährlich das gesamte Personal (sei es auf Mitarbeiter- oder Spielerebene), aber auch im Außenbereich der Vereine existiert ein hohes Maß an Beziehungsstabilität. Verträge mit Sponsoren werden in der Regel über mehrere Jahre geschlossen, die auch bei sportlichem Misserfolg (z. B. Abstieg) noch ihre Gültigkeit bewahren können. Wenngleich offene Systeme über Austauschprozesse mit ihrer Umwelt eine gewisse Dynamik entwickeln, können deren Zustände selbstverständlich variieren; nicht jeder Wechsel der Umweltbedingungen bedeutet im Gegenzug jedoch eine vollständige Änderung der Systemstrukturen (vgl. Bienert 2002: 10).
Komplexität wird in der Literatur zuhauf als dominante Eigenschaft von Systemen angesehen (vgl. Willke 1993). Systeme sind umso komplexer, je höher die Zahl und Art der Elemente, aus denen sie bestehen, und je höher die Zahl der Interdependenzen und Beziehungen zwischen ihnen (vgl. Schiemenz 1994: 10). Die Komplexität eines Systems wird im wesentlichen durch das Ausmaß an Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit determiniert (vgl. ebd.). Mit Folgelastigkeit wird die Anzahl und das Gewicht der durch eine spezifische Handlung initiierten Folgeprozesse bezeichnet. Vielschichtigkeit meint das Niveau funktionaler Differenzierung (vgl. Wolf 2008: 165). Hier wird also explizit Bezug auf das Ergebnis von Interaktion und Beziehungen von Systemen und Systemelementen genommen (vgl. Macharzina 1981: 43f.). Unter Vernetzung wird die Art und der Umfang wechselseitiger Abhängigkeiten verstanden, die das System intern und extern betreffen (vgl. Wolf 2008: 165), und die in der vorliegenden Arbeit auch vordergründig betrachtet werden. Willke (1993) ist der Auffassung, dass je vielschichtiger ein System ist, also je höher die funktionale Differenzierung erscheint, desto eklatanter sind die wechselseitigen Interdependenzen im System (vgl. Willke 1993).
Aufgrund dieser Erkenntnisse werden die Systeme, die den Forschungsgegenstand betreffen, ganzheitlich gesehen. Eine isolierte Betrachtung einzelner Teilelemente wird vernachlässigt.
4.2.1 Spezifikation von Systemgrenzen
Betrachtet man nun offene Systeme wie Unternehmen (Sponsoren) oder Vereine (Gesponserte), muss man sich zwangsläufig mit der Frage der Systemgrenze beschäftigen (vgl. Willke 1993). Elemente und Teileinheiten von Systemen können auch Teil anderer Systeme sein. So wird dies bei der Verknüpfung von Sponsorgeber und -nehmer in vielen Situationen offensichtlich. Der FC Bayern München hat in der jüngeren Vergangenheit einen „Verhaltenskodex“ erlassen, nach dem sich alle Mitglieder der Lizenzspielermannschaft zu gewissen Aktionen verpflichten, die dem Ansehen des Vereins zuträglich sind. So verlangt dieser Kodex auch, die Exklusivität der Sponsoren zu sichern: „Bei offiziellen Anlässen des FC Bayern ist dafür Sorge zu tragen, dass ausschließlich mit Produkten von Sponsoren des FC Bayern aufgetreten wird“ (Bergmann 2009). Es wird deutlich, dass auch nach außen eine Verbindung zwischen Sponsor und Gesponsertem verdeutlicht werden soll - die eigentlichen Systemgrenzen scheinen in solchen Fällen also eher fließend zu sein.
Bei der Systembildung unterscheidet die Systemtheorie zum besseren Vergleich Ebenen in dreierlei Hinsicht (vgl. Abb. 2). Soziale Systeme haben dabei keine empirisch belegbaren Systemgrenzen, sie grenzen sich allerdings aus ihrer Umwelt ab (vgl. Steinmann/Schreyögg 1993: 64).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Systembildung auf drei Ebenen (modifiziert nach Luhmann 1999: 16).
Die Systemarten Unternehmen und Verein werden der dritten Ebene zugeordnet und sind damit als soziale Systeme zu verstehen.
4.2.2 Menschenbild
Komplexe sozio-ökonomische Systeme können durchaus einen bestimmten Menschentyp hervorbringen, da die mehrdimensionalen Beziehungen sozialer, sportlicher, ökonomischer, politischer oder ökologischer Natur innerhalb und außerhalb des Systems zu einem mannigfaltigen Zielbündel führen. Dieser Menschentyp ist geprägt von einem Handeln, das nicht ausschließlich an materiellen Gesichtspunkten ausgerichtet ist. Komplexe Denk- und Bewertungsstrukturen sind dem Mensch der Systemtheorie zu eigen. Er ist daher nicht nur wandlungsfähig, sondern unterliegt einem ständigen dynamischen Wesenswandel, welcher seine Präferenzen, Motive und Anschauungen betrifft (vgl. Rolle 2005: 236). Als lernfähiges Wesen kann der Mensch Erlerntes und Erfahrungen bei seinen Entscheidungen berücksichtigen und wird sich daher abhängig von der jeweiligen Situation individuell unterschiedlich verhalten (vgl. ebd.). Der Menschentyp der Systemtheorie kommt damit dem „complex man", wie er von Edgar Schein Mitte der 1960er Jahre modelliert worden ist, am nächsten (vgl. Rolle 2005: 235) und steht daher im diametralen Gegensatz zu dem Menschenbild des Homo Oeconomicus aus der klassischen Erwartungsnutzentheorie (vgl. Kapitel 4.4).
Die Systemtheorie geht nämlich davon aus, dass das (interaktive) Verhalten der handelnden Individuen weder rational noch psychologisch eindeutig erklärbar oder zu antizipieren sei (vgl. Bienert 2002: 14). Es wird untersucht, wie diese anthropologischen Annahmen in den Systembetrachtungen des Sportsponsorings berücksichtigt werden.
4.3 Elias’sche Figurationssoziologie
Im Zentrum der Figurationssoziologie stehen Überlegungen zu dynamischen Netzwerken von untereinander abhängigen Individuen (vgl. u. a. Elias 2009). Der von Elias eingeführte Begriff der Figuration, manchmal auch als „Geflechte zwischenmenschlicher Interdependenzen" (Baumgart/Eichener 1997: 109) bezeichnet, betont das soziale Zusammensein und den Verflechtungszusammenhang von Individuen in spezifischen Konstellationen (vgl. Wolf 1999). „Das Geflecht der Angewiesenheiten von Menschen aufeinander [...] [ist] das, was [hier] als Figuration bezeichnet wird, als Figuration auf einander ausgerichteter, von einander abhängiger Menschen" (Elias 1995: LXVII).
Elias‘ in erster Linie zivilisationstheoretischen Überlegungen werden als allgemeine Theorie betrachtet, die auf sämtliche gesellschaftlichen Phänomene zu übertragen ist (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 103).
4.3.1 Menschenbild
Die Prozess- und Figurationstheorie versucht, mit einem qualitativen Minimum an wie im klassischen Erwartungsnutzenmodell üblichen anthropologischen Annahmen auszukommen (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 105). Elias‘ anthropologische Prämissen orientieren sich am Menschenbild der Systemtheorie und sehen die Menschen als „prinzipiell offene, durch die gesellschaftlichen Umstände formbare Wesen" (ebd.). Menschen sind nach Elias „fundamental gesellschaftlich" und „existenziell gruppenbezogen" (Rathmayr et al. 2009: 11) eingestellt - sie sind dazu während ihres gesamten Lebens von anderen Menschen abhängig (vgl. ebd.). Der Mensch ist also von klein auf in einer nie endenden Interdependenz mit seinen Mitmenschen ein gruppenbezogenes Wesen, das wandelbare Züge aufweist (vgl. Elias 1995: LXVII).
Der Figurationssoziologie zufolge existiert der Mensch „nur als Pluralitäten, nur in Figurationen" (ebd.). Daher steht eine spezifische Perspektive auf das Individuum im Zentrum dieser Theorie. Der Akteur handelt in einem „Interdependenzgeflecht aufeinander ausgerichteter, mehr oder weniger voneinander abhängiger Menschen [...] und [ist] den Handlungen anderer ausgesetzt" (Wolf 1999: 117).
Deswegen eignet sich die theoretische Basis der Elias’schen Figurationssoziologie durchaus auch für die (sozialen) Interdependenzen in der Figuration „Sponsoring im Fußball", in der ebenfalls machtbezogene Spannungsgleichgewichte zwischen Verein als Sponsornehmer und Unternehmen als Sponsorgeber herrschen, die auch in dem von Elias (1995) beschriebenen Figurationsprozess existieren (vgl. Elias 1995: 142f.).
4.3.2 Macht und Machtbalancen
„Im Zentrum der wechselnden Figurationen [...] steht ein fluktuierendes Spannungsgleichgewicht, das Hin- und Her einer Machtbalance, die sich bald mehr der einen, bald mehr der anderen Seite zuneigt. Fluktuierende Machtbalancen gehören zu den Struktureigentümlichkeiten jedes Figurationsstromes" (Elias 1995: 142f.).
Von dem Phänomen der Macht[11] kann immer dann gesprochen werden, wenn Menschen ihr Handeln nicht vollständig selbst bestimmen können, sondern in irgendeiner Art und Weise von anderen Akteuren abhängig sind (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 114).
Für Max Weber (1972) bedeutet Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen" (Weber 1972: 28). Demnach ist Macht als Fähigkeit anzusehen, jemand anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, das dieser unter regulären Umständen nicht zeigen würde. Das jeweilige Machtpotential hängt also immer auch von der Machtfülle derjenigen Person ab, die zu einem bestimmten Verhalten geführt werden soll (vgl. Grieger 2004: 175). Selbst der offensichtlich schwächere Partner einer Figuration ist fähig, auch Macht auf den Stärkeren ausüben, solange er einen Wert für ihn darstellt und allein deshalb der „Stärkere" schon von dem „Schwächeren" abhängt (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 115f.).
Das Phänomen der Macht ist in jeglichen Bereichen gesellschaftlichen Zusammenlebens vorzufinden. Besonders dann, wenn gewisse Entscheidungsspielräume vorliegen (z. B. bei Verhandlungen).
Das Podolski-Beispiel in Kapitel 4.2 hat gezeigt, welchen Einfluss, also welche Macht, bereits eine einzelne Person ausüben kann. Macht ist also oft personengebunden und darüber hinaus gilt das Streben nach solcher Simon (1982) zufolge als menschliches Persönlichkeitsmerkmal (vgl. Simon 1982).
Das Phänomen der Macht ist jedoch nicht ausschließlich den persönlichkeitsspezifischen Charakteristika zuzuordnen, sondern ist vielmehr Resultat einer Beziehung zwischen (mindestens) zwei Spielern, z. B. dem Unternehmen als Sponsorgeber und dem Sportverein als Sponsornehmer. Das Machtphänomen kann ferner auch als Produkt des im gesellschaftlichen Kontext bestehenden institutionellen Rahmens aufgefasst werden (vgl. Wolf 2008: 267): Macht resultiert also auch im besonderen Umfang aus dem strukturellen Umfeld, in dem die gesellschaftliche Interaktionsbeziehung zustande kommt.
Macht ist demnach keine Eigenschaft, die man „besitzt" - sondern ein Beziehungsbegriff. „Besitzen" kann man jedoch Quellen der Macht, beispielsweise Geld (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 115).
Insbesondere im Rahmen der präskriptiven Entscheidungstheorie (vgl. Kapitel 4.6) sind machtbezogene Überlegungen von Bedeutung, da sie die Evaluation von Handlungsalternativen durch Entscheidungsträger beeinflussen können.
Bezogen auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit, die Sponsor- Vereins-Beziehung in der Fußball-Bundesliga, gilt es zu untersuchen, wie stark hier dieses Machtdifferential ausgebildet ist und ob sich eine zu identifizierende Machtbalance in den Beziehungs- und Entscheidungsstrukturen im Sportsponsoring widerspiegelt.
4.4 Die klassische Erwartungsnutzentheorie
„He is neither tall nor short, fat nor thin, married nor single. There is no telling whether he loves his dog, beats his wife or prefers pushpin to poetry. We do not know what he wants. But we do know that, whatever it is, he will maximize ruthlessly to get it" (Hollis/Nell 2007: 54). Tietzel (1981) beschreibt den Homo Oeconomicus in einer ähnlichen Weise: „Man hat ihm nachgesagt, er pflege jede Nacht im Bett zu lesen, sofern der Nutzen des Lesens für ihn den Ertrag aus dem verpaßten Geschlechtsverkehr mit seiner Frau überkompensiere [...]“ (Tietzel 1981: 117).
Das Konstrukt der klassischen Erwartungsnutzentheorie mitsamt ihres Modells des Homo Oeconomicus rückt also das Verhalten des rationalen, egoistischen Menschen in den Vordergrund, der sich bei Entscheidungen vom Prinzip der Maximierung des eigenen Nutzens leiten lässt und dabei über eine stabile Präferenzordnung verfügt (vgl. Pelzmann 2000: 5; Wilkinson 2008: 5; Homann/Suchanek 2005: 363). Das Handeln dieses nach dem optimalen Nutzen strebenden Subjekts wird durch positive und negative Anreize - den monetären Kategorien Gewinn und Verlust zuzuordnen - bestimmt (vgl. Pelzmann 2000: 6).
Der trägheits- und emotionslose, zweck- und zielgerichtete Homo Oeco- nomicus gilt zudem durch Erkenntnisse und Erwartungen der Wahrscheinlichkeitstheorie nach Bayes beeinflusst (vgl. Maurer/Schmid 2002: 24). Zusätzlich besitzt er jegliche Informationen, die seinen Entscheidungen dienlich sind und lässt sich bei diesen auch nicht von externen Faktoren, beispielsweise von anderen Menschen, beeinflussen (vgl. Wilkinson 2008: 5). Das Modell vernachlässigt jegliche Aspekte menschlichen Verhaltens, die nicht unmittelbar dazu dienen, wirtschaftliches Handeln zu erklären und vorherzusagen (vgl. Pelzmann 2000).
[...]
1 Im weiteren Verlauf wird zugunsten der besseren Lesbarkeit jeweils nur die männliche Form verwendet.
2 Für eine weiterführende Betrachtung des Feldes Sponsoring-Controlling vgl. Bihn (2006) oder Marwitz (2006).
3 In Kapitel 5.1 finden sich alternative Arten von Sponsoring (vgl. u. a. Hermanns 1989).
4 Zum Begriff der Figuration vgl. Kapitel 4.3.
5 vgl. dazu die E-Mail-Korrespondenz mit Prof. Drees bzw. Prof. Hermanns im Anhang E.
6 Eine ausführliche Definition zum Begriff des Sponsorings findet sich in Kapitel 5.1.
7 Da es sich bei den meisten Sponsoringvereinbarungen um leistungsbezogene Verträge handelt (vgl. Linnenbrügger 2005), wird sich die Gesamtsumme nach Ablauf der Saison voraussichtlich noch weiter nach oben korrigieren.
8 Für die Vertreter des Methodologischen Individualismus stellt sich das Kollektiv als Summe seiner Teile dar (vgl. Vanberg 1982: 65). Daher ist die Betrachtung individuellen Verhaltens durchaus sinnvoll. Auch das betrachtete Menschenbild der jeweiligen Theoriekonstrukte (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.3.1) erscheint hier passend.
9 Für eine Definition des Begriffs „Institution“ vgl. u. a. Richter/Furubotn 2003.
10 Zur Anreiz-Beitrags-Theorie nach Barnard vgl. Barnard 1971; Schreyögg 2008.
11 Eine Machtbeziehung ist nach Elias‘ Vorstellungen immer wechselseitig, ohne symmetrisch sein zu müssen (vgl. Baumgart/Eichener 1997: 114f.). Deshalb ersetzt Elias (2009) den Machtbegriff durch den Begriff der Machtbalance bzw. des Machtdifferentials (vgl. Elias 2009: 92f.).