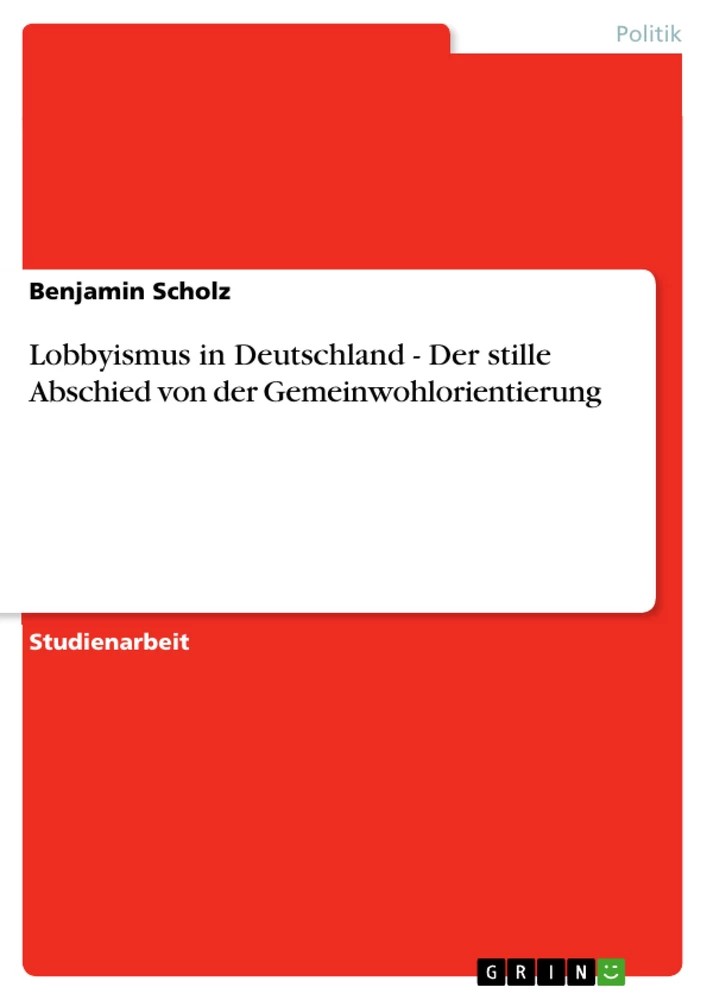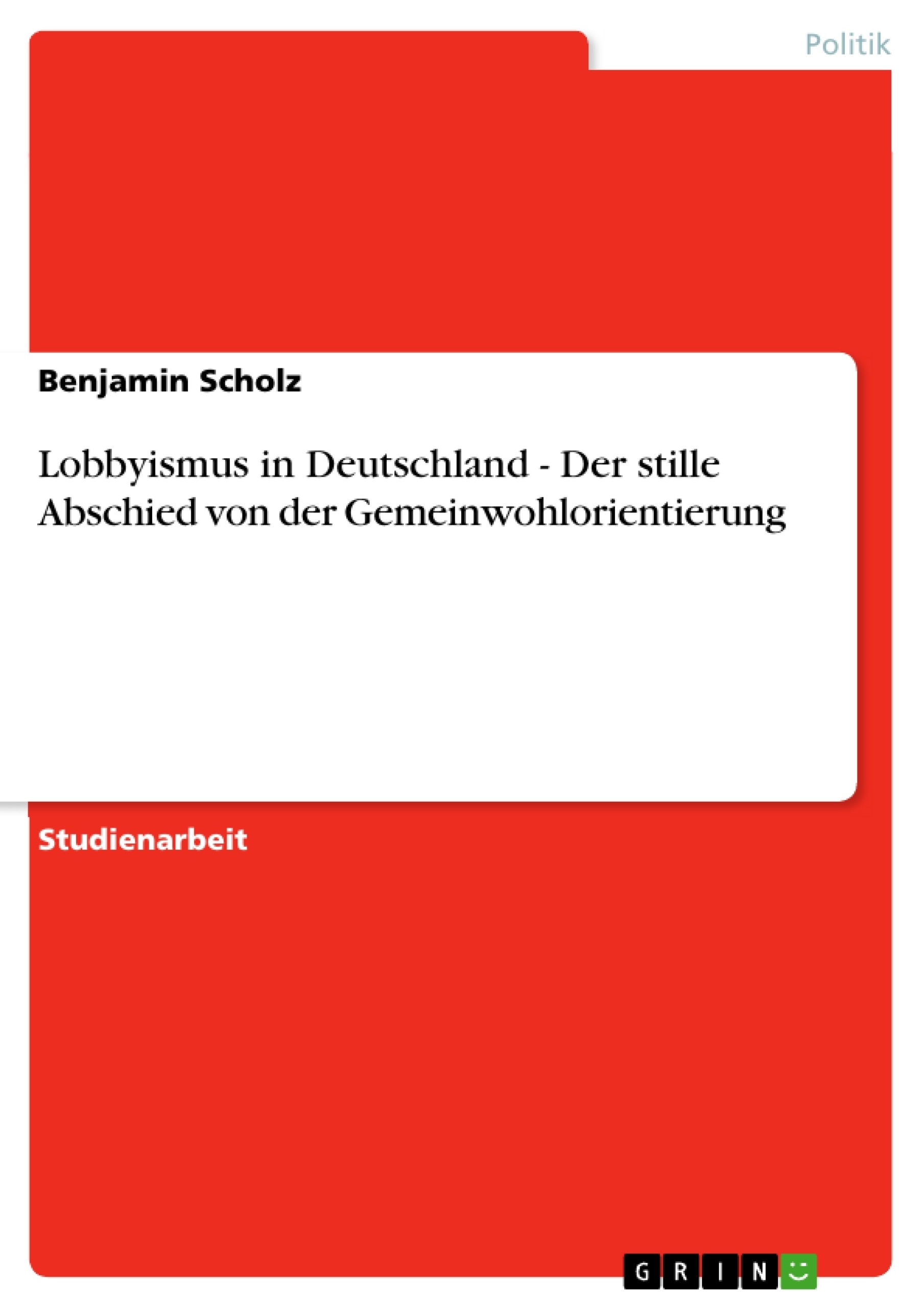INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1 THEMA UND RELEVANZ
1.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
1.3 THEORIE
1.4 METHODIK UND GLIEDERUNG
2. HAUPTTEIL
2.1 LOBBYISMUS - DEFINITION UND VORTEILE
2.2 DIE BEDEUTUNG DES BUNDESTAGES ALS GESETZGEBENDE VERSAMMLUNG
2.2.1 DIE PARTEIEN
2.2.2 DIE BUNDESREGIERUNG
2.2.2 DER BUNDESRAT
2.3 VERÄNDERUNGEN IN DER LOBBYISMUS-LANDSCHAFT
2.3.1 BEDEUTUNGSVERLUST DER ARBEITNEHMERVERTRETUNGEN AM BEISPIEL DES DGB
2.3.2 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ARBEITGEBERVERBÄNDE
2.3.3 NEUE AKTEURE
2.4 ANZEICHEN EINER DAUERHAFTEN ELITEN-ALLIANZ
2.4.1 DEMOKRATIEDEFIZIT DURCH INTRANSPARENZ
2.4.2 ABGEORDNETE UND EXTERNE MITARBEITER ALS BEZAHLTE LOBBYISTEN
2.4.3 DAS „DREHTÜREN-PHÄNOMEN“
3. FAZIT
4. ANHANG
4.1 QUELLENVERZEICHNIS
4.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
4.2 DATENBLATT STATISTIK GESETZESINITIATIVEN
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1 Thema und Relevanz
1.2 Fragestellung und Hypothesen
1.3 Theorie
1.4 METHODIK UND GLIEDERUNG
2. HAUPTTEIL
2.1 Lobbyismus - Definition und Vorteile
2.2 Die Bedeutung des Bundestages als gesetzgebende Versammlung
2.2.1 DIE PARTEIEN
2.2.2 Die Bundesregierung
2.2.2 Der Bundesrat
2.3 Veränderungen in der Lobbyismus-Landschaft
2.3.1 Bedeutungsverlust der Arbeitnehmervertretungen am Beispiel des DGB
2.3.2 Herausforderungen für die Arbeitgeberverbände
2.3.3 Neue Akteure
2.4 Anzeichen einer dauerhaften Eliten-Allianz
2.4.1 Demokratiedefizit durch Intransparenz
2.4.2 Abgeordnete und externe Mitarbeiter als bezahlte Lobbyisten
2.4.3 DAS „DREHTÜREN-PHÄNOMEN“
3. FAZIT
4. ANHANG
4.1 Quellenverzeichnis
4.2 Abbildungsverzeichnis
4.2 Datenblatt Statistik Gesetzesinitiativen