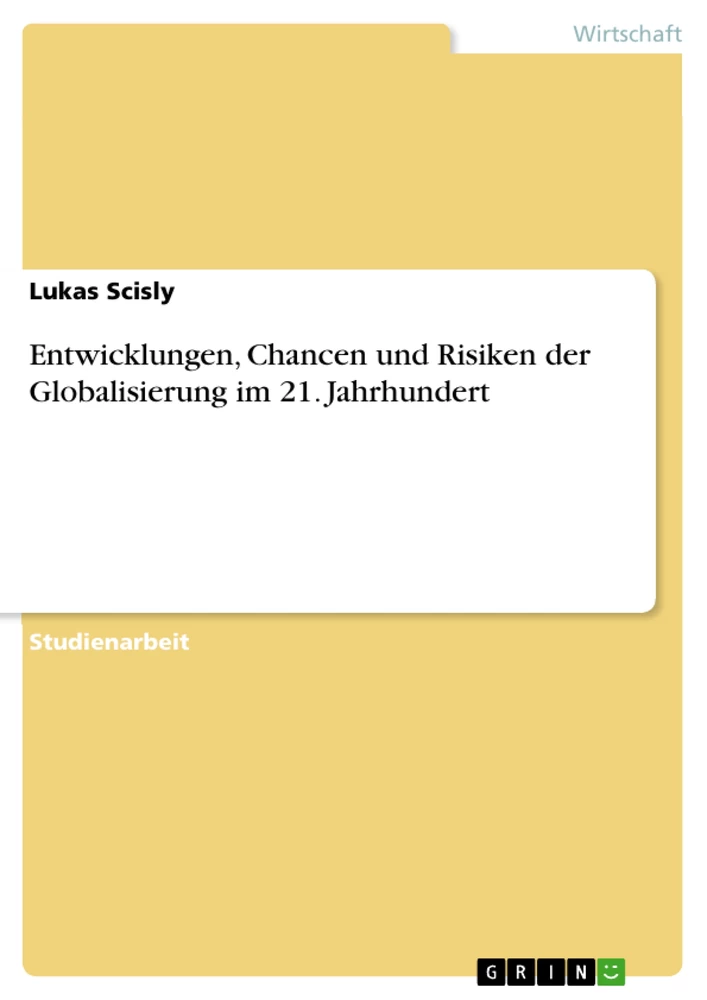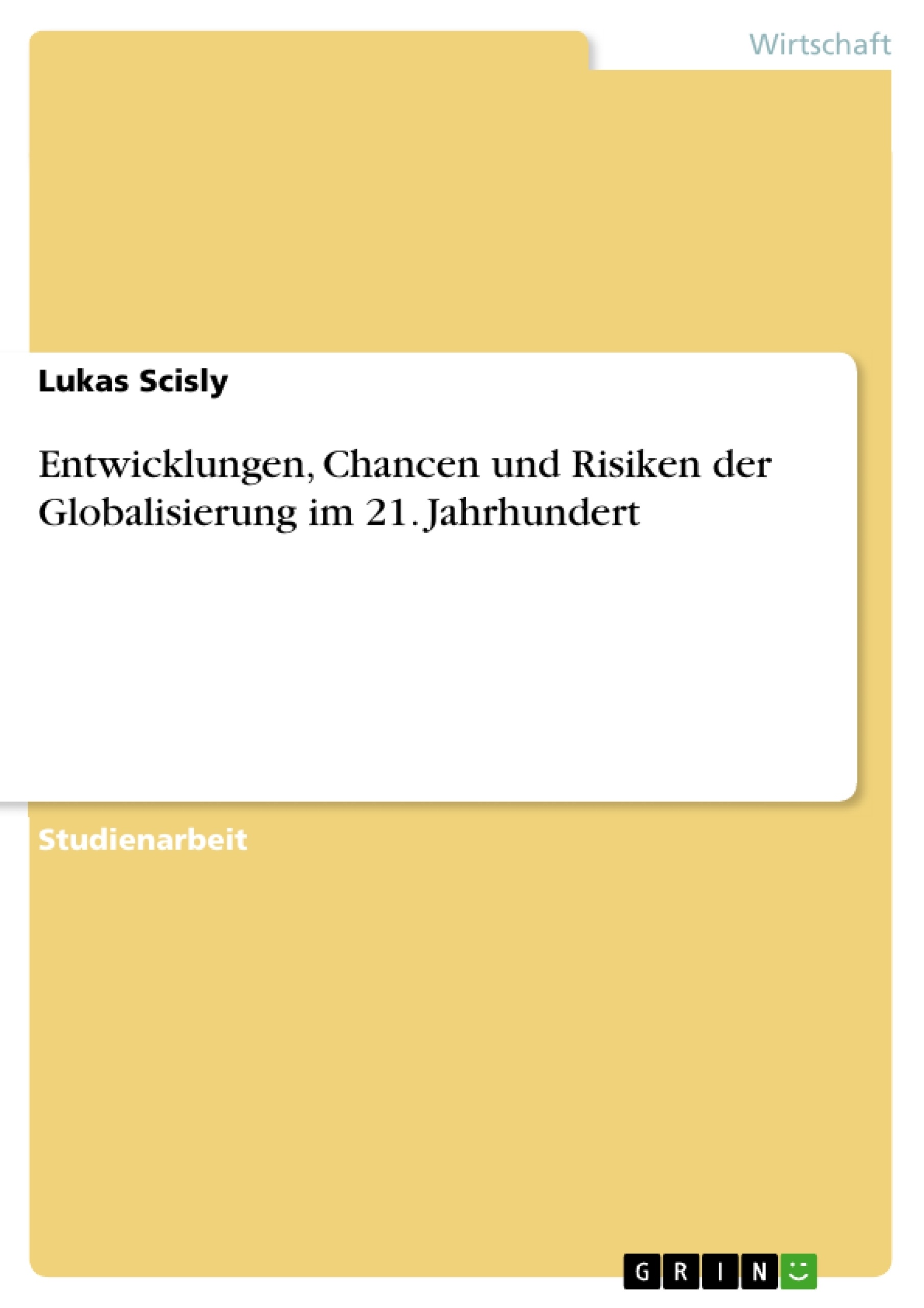Die Globalisierung ist ein Prozess, der seit den 1990er Jahren zunehmend Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erzielt und sehr kontrovers diskutiert wird. Für die einen stellt sie eine unaufhaltsame positive Entwicklung für alle Beteiligten dar und bietet viele Chancen, für die anderen ist sie eher eine Bedrohung,
die sich nur schwer kontrollieren lässt. Obwohl Deutschland als derzeit exportstärkste Nation stark von der Globalisierung der Märkte profitiert, wächst hierzulande die Skepsis: Während im Jahr 1996 noch 25 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage mehr Risiken als Chancen in der Globalisierung sahen, stieg dieser Wert im Jahr 2006 auf 47 Prozent.1 Welche Chancen und Risiken durch die Globalisierung für Deutschland im 21. Jahrhundert tatsächlich entstehen können, soll Ziel der vorliegenden Ausarbeitung sein.
Dabei wird zu Beginn der Globalisierungsprozess begrifflich erläutert und seine historische Entwicklung übersichtlich dargestellt. Es wird auch auf die wichtigsten Akteure des Prozesses eingegangen. Darauf aufbauend werden die Entwicklungen der Globalisierung im 21. Jahrhundert dargestellt, wobei zunächst auf globale Entwicklungen und anschließend auf die Auswirkungen auf deutsche Unternehmen sowie auf den inländischen Arbeitsmarkt eingegangen wird. Schließlich werden mögliche Chancen und Risiken, die sich aus der Globalisierung
ergeben dargestellt. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse
in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Globalisierung
2.1 Historische Entwicklung
2.1.1 Praglobale Epoche
2.1.2 Protoglobalisierung
2.1.3 Erste Globalisierungsphase
2.1.4 Zeit der Gegenlaufe
2.1.5 Zweite Globalisierungsphase
2.1.6 Dritte Globalisierungsphase
2.2 Akteure im Globalisierungsprozess
2.2.1 Multinationale Unternehmen
2.2.2 Internationale Regierungsorganisationen
2.2.3 Internationale Nichtregierungsorganisationen
3 Globalisierung im 21. Jahrhundert
3.1 Globale Entwicklungen
3.2 Wirkungen auf Deutschland
3.2.1 Wirkungen auf deutsche Unternehmen
3.2.2 Wirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
3.3 Chancen und Risiken fur Deutschland
3.3.1 Chancen
3.3.2 Risiken
4 Fazit
Literaturverzeichnis