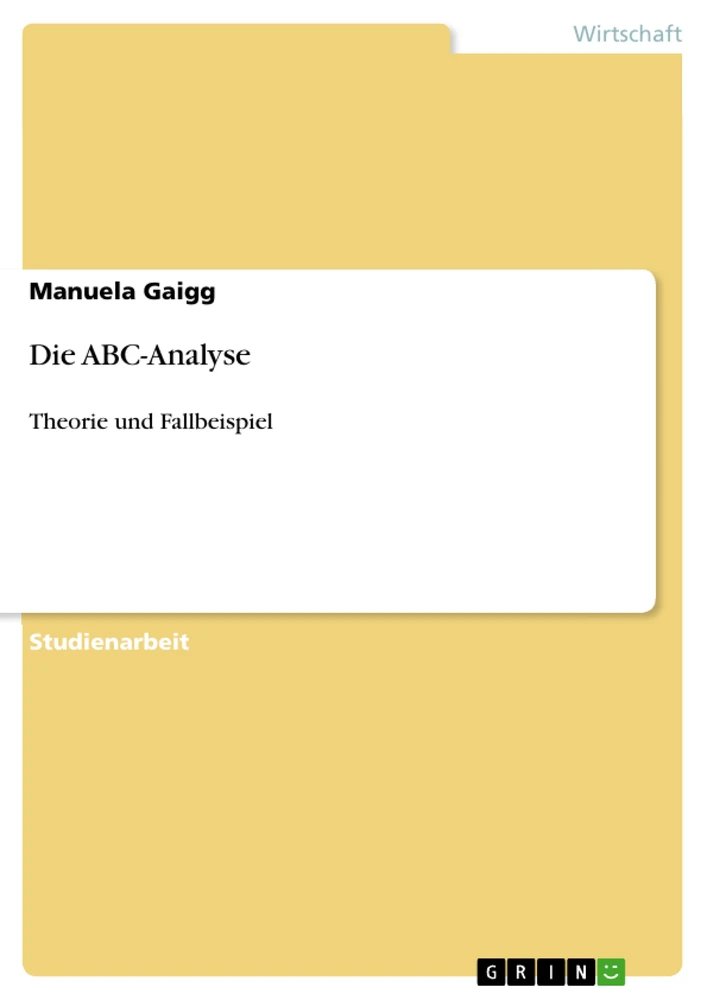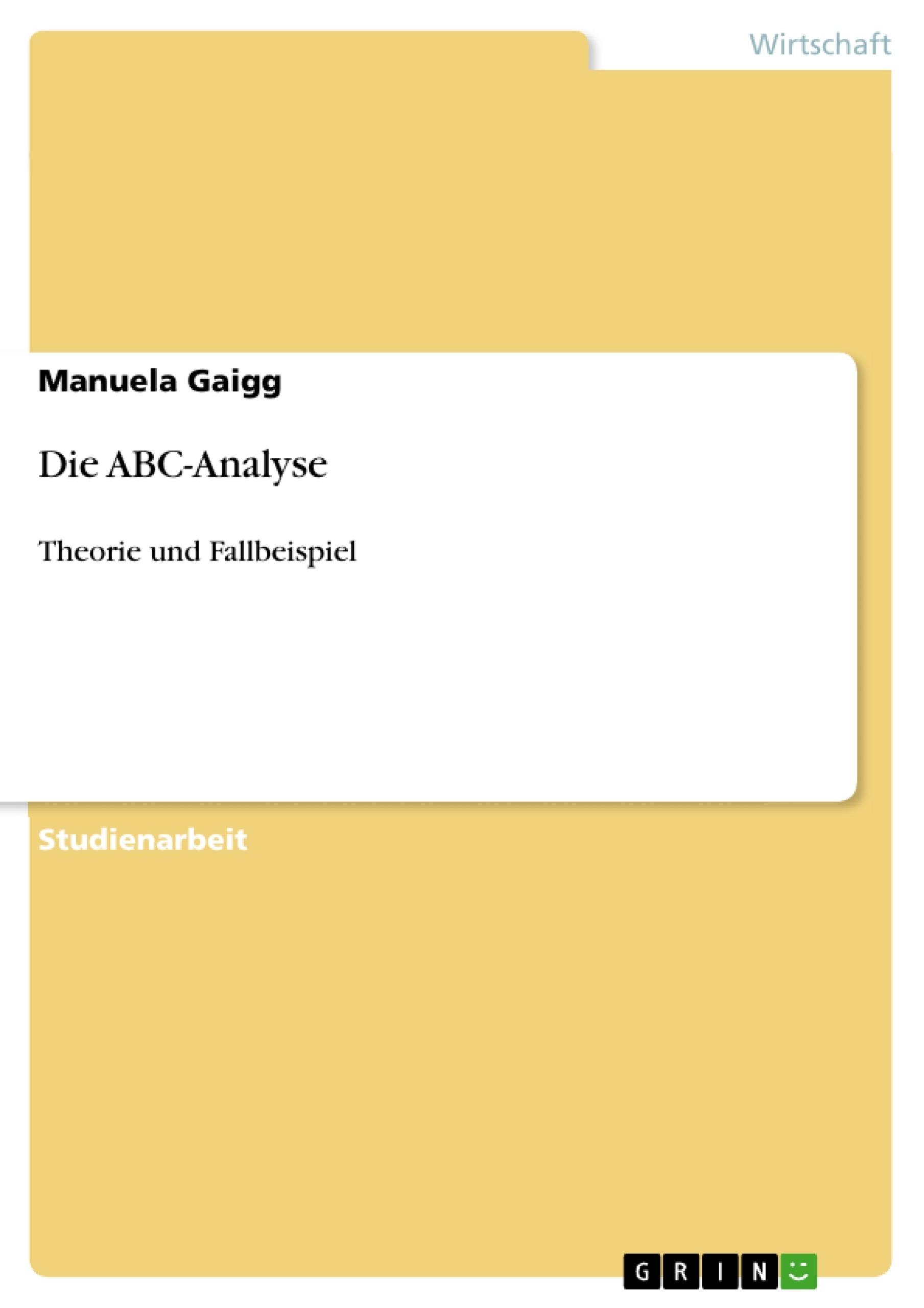Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Instrument, welches versucht die Prioritätenreihung und Schwerpunktsetzung in Unternehmen zu erleichtern, der ABC-Analyse. Als Einstieg werden der Begriff, die Herkunft sowie der Zweck der ABC-Analyse erläutert. Danach wird auf die Vielfältigkeit der ABC-Analyse eingegangen, wobei zwei Anwendungsgebiete ausführlicher erläutert werden. Im nächsten
Abschnitt wird die XYZ-Analyse - eine Erweiterung der ABC-Analyse - vorgestellt. Um die praktische Relevanz der ABC-Analyse darzustellen, wird im letzten Abschnitt der Arbeit ein selbst konzipiertes Fallbeispiel demonstriert. Die Arbeit schließt mit einem persönlichen Fazit.
Inhalt
Darstellungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist die ABC-Analyse
2.1. Die Entstehung der ABC-Analyse
2.2. Der Zweck der ABC-Analyse
3. Die Anwendungsgebiete der ABC-Analyse
3.1. Die ABC-Analyse in der Absatzwirtschaft
3.1.1. Die Anwendung der ABC-Analyse in der Absatzwirtschaft
3.1.2. Erkenntnisse der ABC-Analyse in der Absatzwirtschaft
3.2. Die ABC-Analyse in der Material- und Lagerwirtschaft
3.2.1. Die Anwendung der ABC-Analyse in der Material- und Lagerwirtschaft
3.2.2. Erkenntnisse der ABC-Analyse in der Material- und Lagerwirtschaft
3.3. Die ABC-Analyse im Zeitmanagement
3.3.1. Die Anwendung der ABC-Analyse im Zeitmanagement
3.3.2. Erkenntnisse der ABC-Analyse im Zeitmanagement
3.4. Die ABC-Analyse im Dienstleistungsmanagement
3.4.1. Die Anwendung der ABC-Analyse im Dienstleistungsmanagement
3.4.2. Erkenntnisse der ABC-Analyse im Dienstleistungsmanagement
4. Die XYZ-Analyse als Ergänzung zur ABC-Analyse
4.1. Die Anwendung der XYZ-Analyse
4.2. Erkenntnisse der XYZ-Analyse
5. Praxisbeispiel
5.1. Aufgabenstellung
5.2. Die Anwendung der ABC-Analyse
5.3. Erkenntnisse der ABC-Analyse
6. Fazit