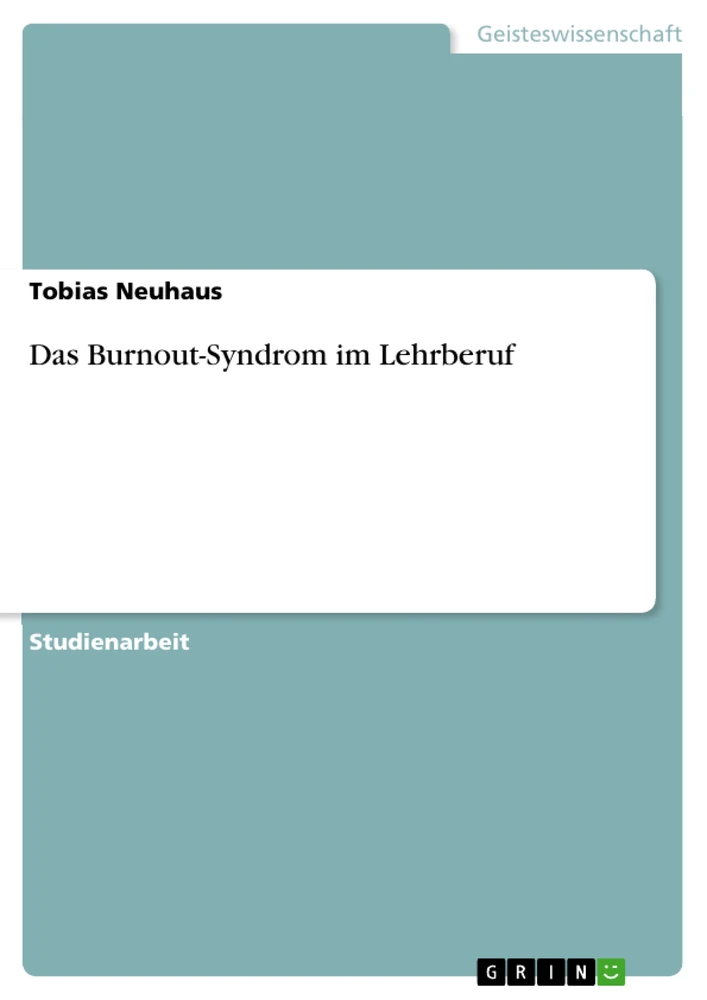1. Einleitung
[...] Wird ein Blick auf Statistiken geworfen, so wird ersichtlich, dass unter allen Berufen im Lehrerberuf am häufigsten auf psychologische Behandlungen zurückgegriffen wird. Bei genauerer Begutachtung des Burnout-Syndroms wird allerdings schnell erkennbar, dass es keine einheitliche Definition für das Syndrom gibt. Ebenso ist es problematisch, bestimmte Symptome ausschließlich dem Burnout-Syndrom zuzuordnen, da sie immer von Person zu Person variieren. Ein weiteres Problem ist, dass die Symptome auch oft bei anderweitigen Krankheiten auftreten und somit auch bei Menschen, die nicht vom Burnout betroffen sind. Die jeweiligen Phasen, die ein Betroffener während des Burnout-Syndroms durchläuft, sind zudem in der Forschung umstritten bzw. nicht kongruent.
Durch diese Unstimmigkeiten stellt sich erstens die Frage, wie sich der Begriff Burnout bestimmen bzw. eingrenzen lässt und zweitens, welche Symptome in der Regel auf das Burnout-Syndrom hinweisen. Außerdem wird der Frage nachgegangen, welche Unterschiede es zwischen den Phasen des Burnoutverlaufs innerhalb der Forschung gibt und welche Verbindung zwischen dem Burnout-Syndrom und Stress besteht. Die Beziehung zwischen Burnout und Stress wird thematisiert, weil viele Lehrkräfte – wie bereits erwähnt – erheblich unter diesen Problemen leiden und Burnout oft als Folge von Stress gesehen wird. Abschließend wird die Frage nach der Prävention von Stress und Burnout im Lehrerberuf geklärt. Andere Berufszweige werden bewusst außer Acht gelassen, um die Arbeit einzugrenzen und um nachvollziehen zu können, warum gerade Lehrer und Lehrerinnen oft vom Burnout bedroht bzw. betroffen sind.
Für die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt einleitend eine Annäherung an die Begriffsbestimmung und Begriffsabgrenzung des Terminus Burnout. Darauf folgend werden die Symptome von Burnout und drei Phasen des Burnoutverlauf aufgegriffen, wobei es sich bei den Phasen um die klassische Entwicklung nach Malsach & Jackson, sowie dem Burnoutverlauf nach Freudenberger und den Verlauf nach Burisch handelt. Im Anschluss wird das Burnout-Syndrom mit Stress in Verbindung gesetzt und das transaktionale Stressmodell von Lazarus vorgestellt. Zuletzt werden die besonderen Belastungen, welche im Lehrerberuf vorzufinden sind, bündig illustriert und einige Präventionsmaßnahmen für Lehrkräfte beleuchtet , um daraufhin im Fazit die Fragestellungen zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Annäherung an die Begriffsbestimmung und Begriffsabgrenzung
3. Symptome von Burnout
4. Phasen des Burnoutverlaufs
4.1 Klassische Entwicklung nach Malsach & Jackson
4.2 Burnoutverlauf nach Freudenberger
4.3 Burnoutverlauf nach Burisch
4.4 Zusammenfassung
5. Stress und Burnout – Das transaktionale Stressmodell von Lazarus
6. Besondere Belastungen im Lehrerberuf
7. Prävention von Stress und Burnout im Lehrerberuf
8. Fazit
Literaturverzeichnis