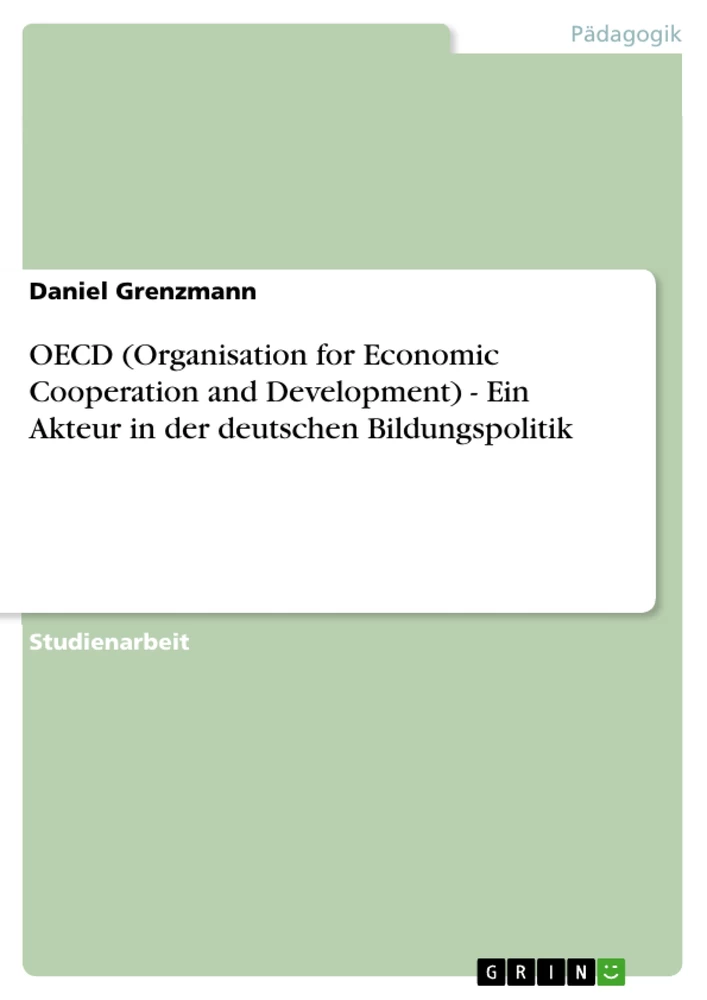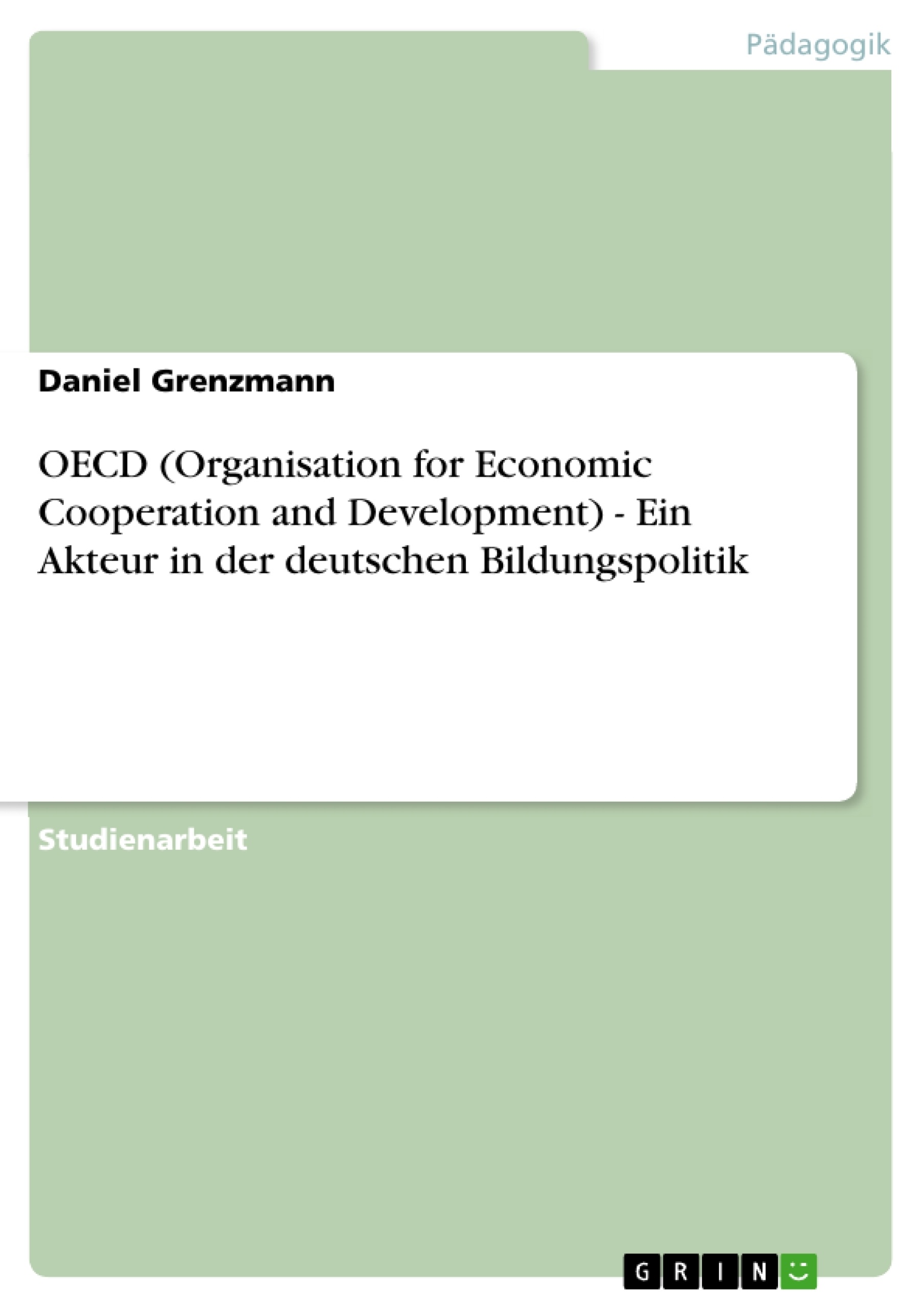Wie alle Politikbereiche, ist auch die deutsche Bildungspolitik keineswegs das Ergebnis eines isolierten und auf sich gestellten Entscheidungsfindungsprozesses. Dabei ist es oftmals unmöglich oder schwer nachzuvollziehen, wer in welchem Maße politische Entscheidungen vorangetrieben und beeinflusst hat.
Institutionen wie Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Berufsverbände, Gewerkschaften, Initiativen und evtl. Kirchen sind jene Akteure die unmittelbar mit der Thematik „Bildungspolitik“ in Verbindung
gebracht werden und ihr den eigenen Stempel aufdrücken wollen. Die Bertelsmann-Stiftung, als einschlägiger Vertreter für alle Stiftungen, engagiert sich zwar stark im Bildungsbereich (z.B. durch das Centrum für Hochschulentwicklung oder das Projekt Selbstständige Schule). Die Wahrnehmung der Einflussnahme von Stiftungen tritt jedoch im Vergleich zu erstgenannten Akteuren in ihrer Bedeutung zurück.
Die Zivilgesellschaft als solche und die Eltern sind Akteure die wahrscheinlich nicht auf der Rechnung als eigene „Interessengruppen“ auftreten. Dass sie Interessen haben steht außer Frage. Ihre Einflussnahme auf die Bildungspolitik wird gemeinhin als nichtexistent angesehen.
Das Meinungsbildungspotenzial von Massenmedien, wie Zeitungsverlage oder Fernsehsendergruppen, wird sicherlich niemand in Abrede stellen. Dass sich dahinter Interessen im Bildungsbereich befinden, ist eher überraschend.
Sogenannte „Think Tanks“ sind aus anderen Gründen eine unbekannte
Größe in der deutschen Bildungspolitik. Sie sind zwar Institutionen, die sich mit reichlich Fachexpertise einer Thematik wie der Bildungspolitik zuwenden, sie sind nur schlichtweg der
deutschen Allgemeinheit unbekannt. In den angelsächsischen Politik und Wirtschaft sind sie hingegen bereits heute etablierte und gefragte „Ideenlieferanten“.
Ein weiterer Akteur soll Thema dieser Arbeit sein. Es handelt sich um die OECD Diese ist ebenfalls der breiten Masse in Deutschland unbekannt, ist jedoch bereits seit einigen Jahrzehnten existent.
Viel bekannter als die Institution hingegen ist eine ihrer Studien – die „PISA“-Studie. Sie hat für Aufsehen und reichlich Gesprächsstoff gesorgt, in Deutschland wie in anderen Ländern. Diese Studie hat den Begriff ‚PISA‘ zum Synonym für eben jene Bildungsstudie verholfen.
Im folgenden wird dargelegt, welche Interessen die OECD in der Bildungspolitik verfolgt und aus welchem Grund.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Entstehung der OECD
3. Heutige Struktur und Zielsetzung
3.1 Mitglieder, Organe und Struktur
3.2 Ziele
4. Interesse an Bildung
5. Bisherige Erfolge
6. Zusammenfassung
7. Bewertung
Literaturverzeichnis