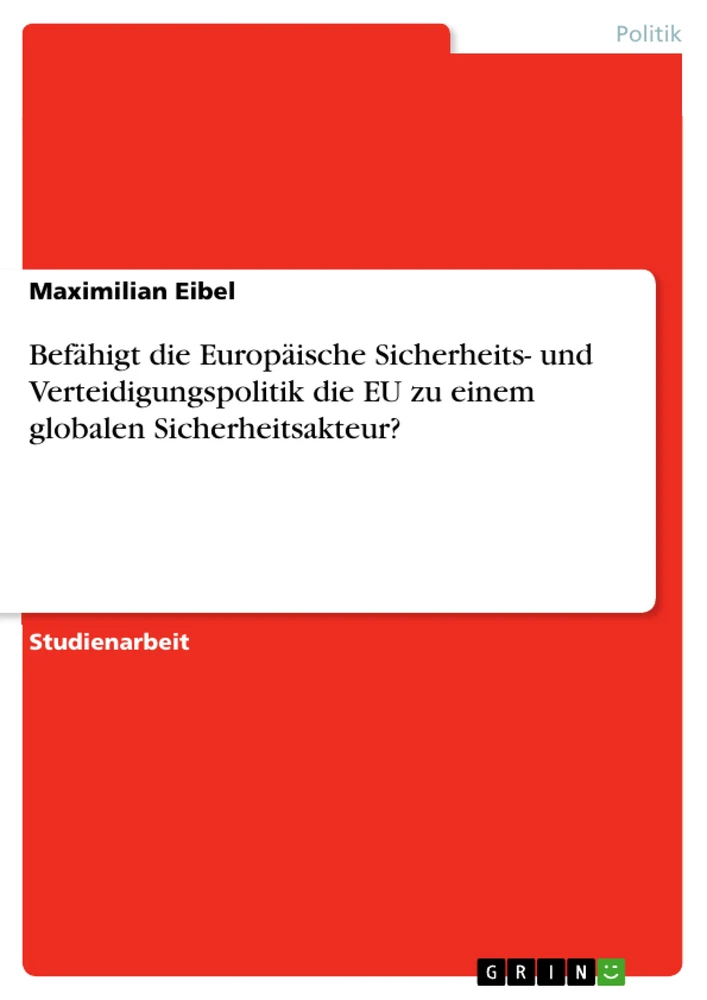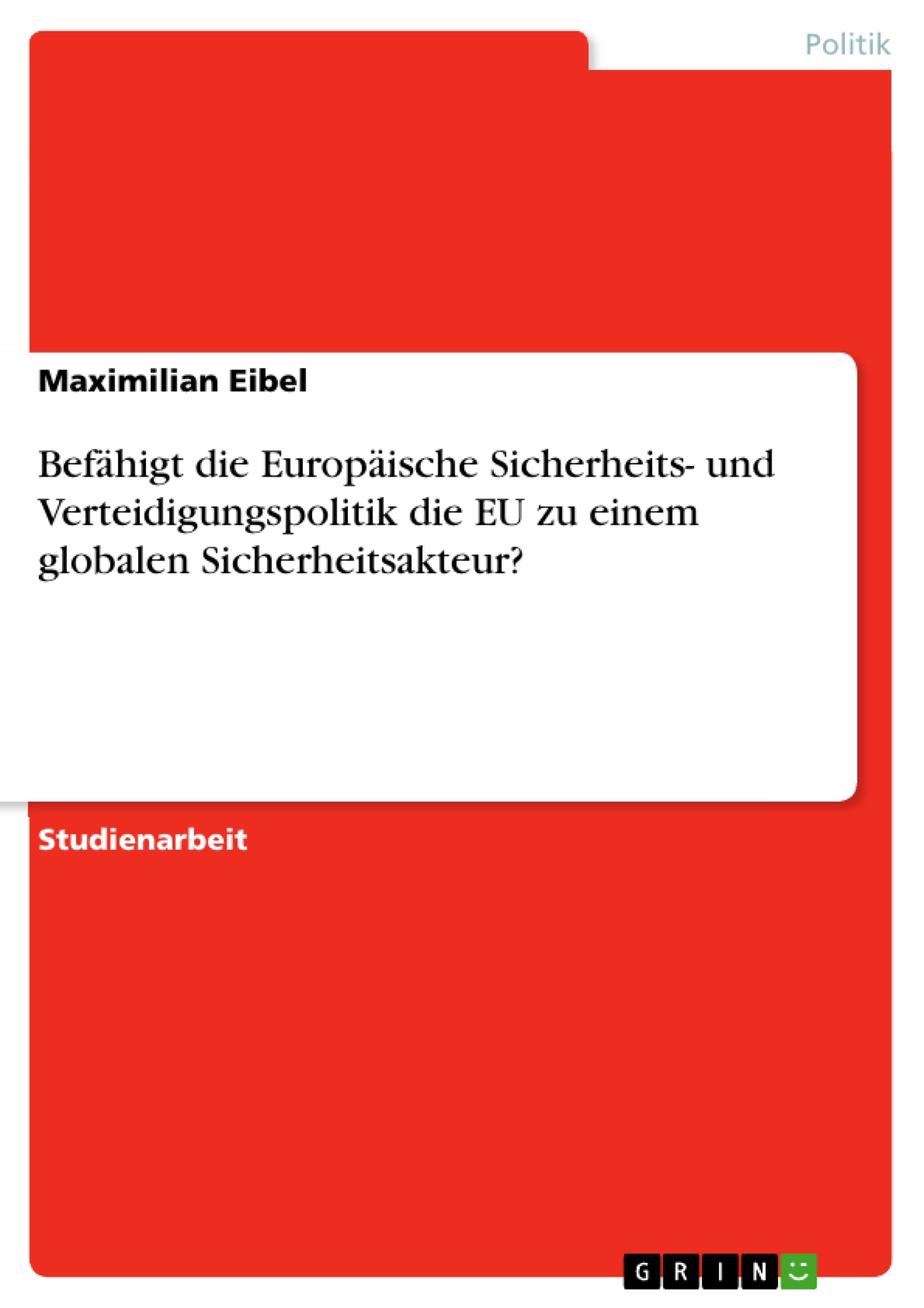Die Europäische Union (EU) unterliegt seit ihrer Gründung einem stetigen Transformationsprozess. Es kommt zu immer tieferen Überschneidungen in verschiedenen Politikfeldern, sowie zur Einbindung weiterer Staaten in die EU. Nach dem Ende des Kalten Krieges war Europa neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen gegenübergestellt, die von ihnen ein gemeinsames Vorgehen abverlangten. Darüber hinaus dehnte sie ihr Engagement als internationaler Akteur immer weiter aus, besonders durch die Implementierung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Rahmen des Vertrags von Maastricht (1992).
Heute besteht die EU aus 27 Mitgliedsstaaten mit ca. 500 Millionen Einwohnern, welche 40% des weltweiten Bruttosozialprodukts erwirtschaften. Aber schon vor den großen Erweiterungen hat es sich die EU zur Aufgabe gemacht, Mitverantwortung für die weltweite Sicherheit zu übernehmen, denn wie schon die Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) erläutert, wird die „erste Verteidigungslinie oftmals im Ausland liegen“ (Europa).
Das hieraus resultierende Problem besteht nun zwischen dem Anspruch Europas, ein globaler Sicherheitsakteur zu sein und den damit verbundenen Aufgaben gerecht zu werden.
Zu Beginn der Arbeit soll ein kurzer Überblick über die sich verändernde ESVP gegeben werden unter Berücksichtigung der Frage, welche entscheidenden Einschnitte zur Weiterentwicklung geführt haben. Des Weiteren sollen die Ziele, Strategie, Aufgaben und Fähigkeiten der ESVP genauer beleuchtet werden, um heraus zu finden, ob die EU ihr vorgegebenes Einsatzspektrum erfüllen kann oder wo noch Mängel bei der Umsetzung bestehen.
Um die Umsetzung besser analysieren zu können, wird diese Arbeit Beispiele untersuchen, durch die genauere Aussagen über die Fähigkeiten der EU als globaler Sicherheitsakteur getroffen werden können.
Gliederung
1. Einleitung
2. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
2.1. Entstehung und Weiterentwicklung der ESVP
2.2. Die militärische Komponente
2.3. Die zivile Komponente
2.4. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa
3. Die Europäische Sicherheitsstrategie
4. ESVP im Einsatz
4.1. EU-Polizeimission Bosnien und Herzegovina (EUPM)
4.2. EU-Militäroperation CONCORDIA in Mazedonien
4.3. EU-Militäroperation ARTEMIS in der Demokratischen Republik Kongo (DRK)
5. Fazit: Die ESVP- Grundstein für die EU als globaler Sicherheitsakteur
6. Literaturverzeichnis