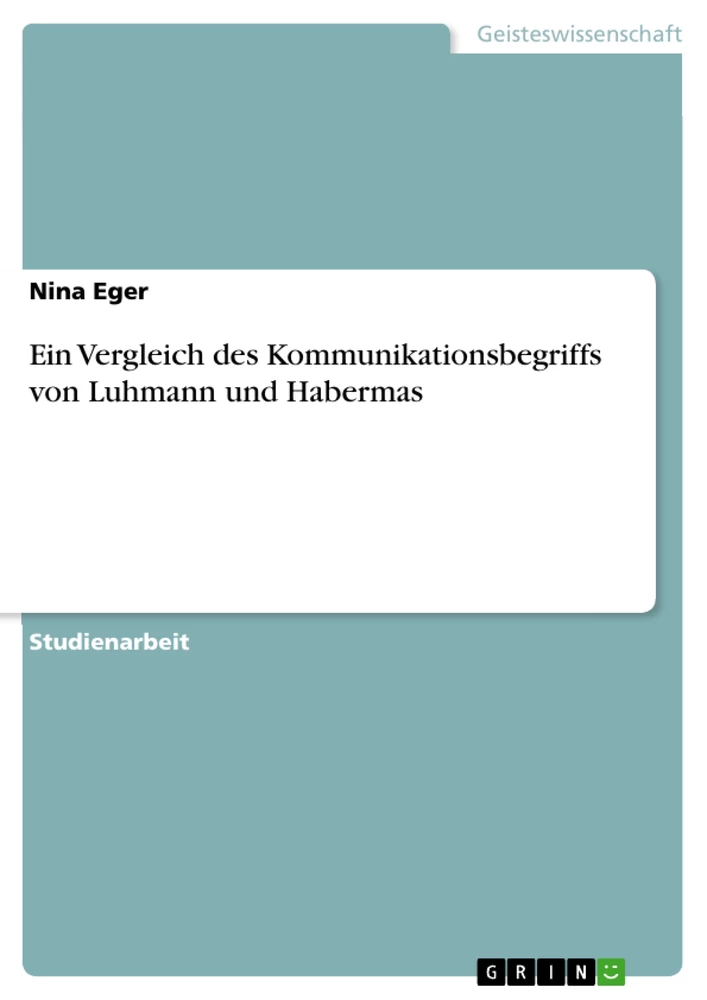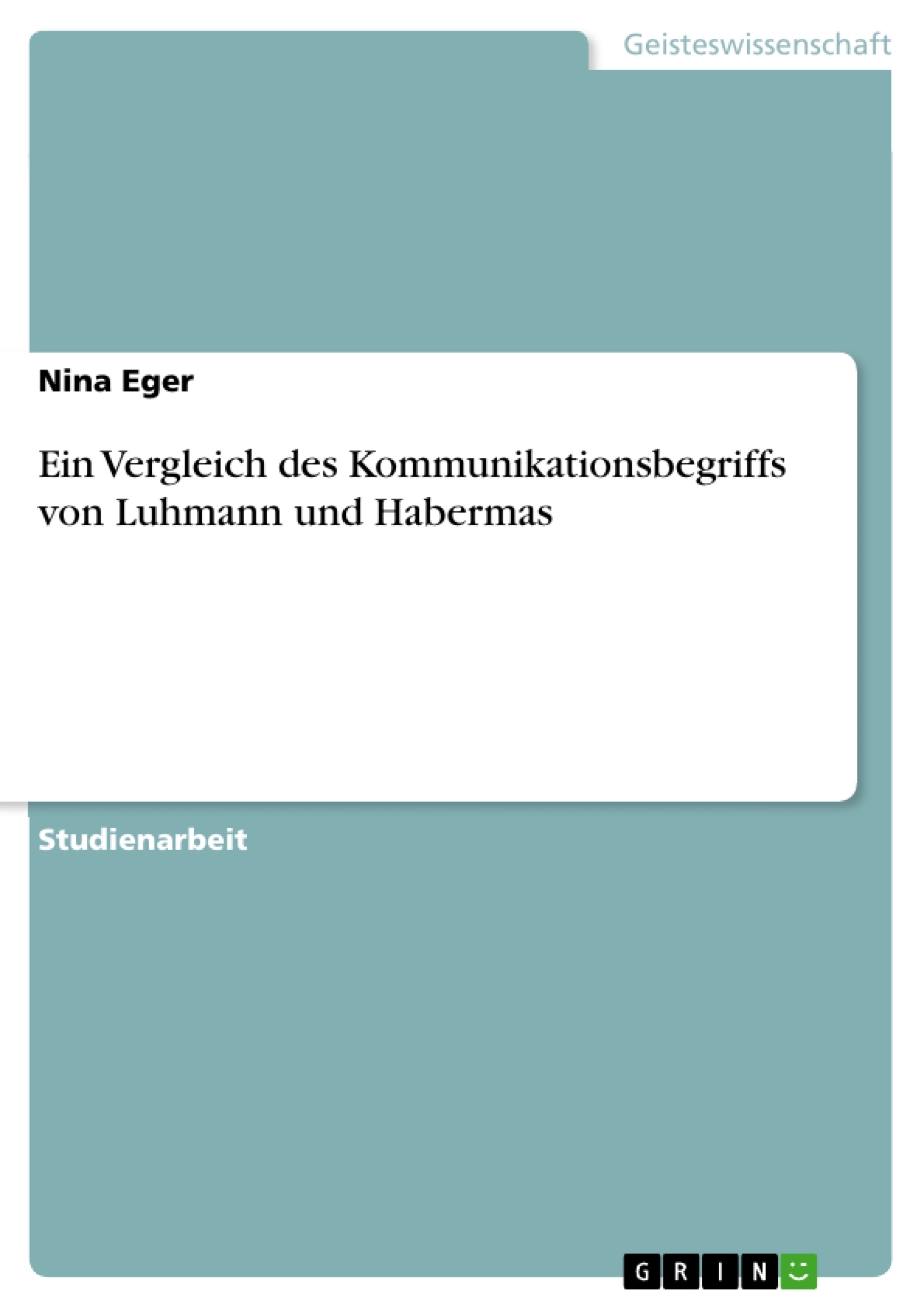Bei Luhmann wie auch bei Habermas spielt Kommunikation für die Möglichkeit sozialer Ordnung jeweils eine zentrale Rolle. Depkat stellt darauf ab, dass die Definitionen von Kommunikation sowie die Auffassung über deren Charakter und die Funktion bei beiden Vertretern völlig unterschiedlich sind (vgl. Depkat 2003: 11). Doch sind die theoretischen Auffassungen wirklich völlig unterschiedlich?
Um den Ähnlichkeiten und Unterschieden in den theoretischen Auffassungen Luhmanns und Habermas näher zu kommen, sollen beide miteinander verglichen werden. Da bei beiden theoretischen Ansätzen die Kommunikation eine entscheidende Rolle spielt, sollen sie auf folgende Frage hin untersucht werden: Was ist die Bedin-gung dafür, dass Kommunikation zustande kommt? Um diese Frage zu beantworten, werden zunächst die Theorien anhand ihrer entscheidenden Begriffe dargestellt. Im Anschluss daran soll der Vergleich stattfinden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Darstellung der Kommunikations- Konzepte
2.1 Luhmann
2.1.1 Doppelte Kontingenz
2.1.2 Elementare Kommunikationseinheit
2.1.3 Anschlusskommunikation
2.1.4 Zusammenfassung
2.2 Habermas
2.2.1 (Nicht signifikante) Geste
2.2.2 Übergang zur symbolisch vermittelten Interaktion
2.2.3 Regeln und Geltungsansprüche
2.2.4 Zusammenfassung
3. Fazit/Vergleich
Literatur