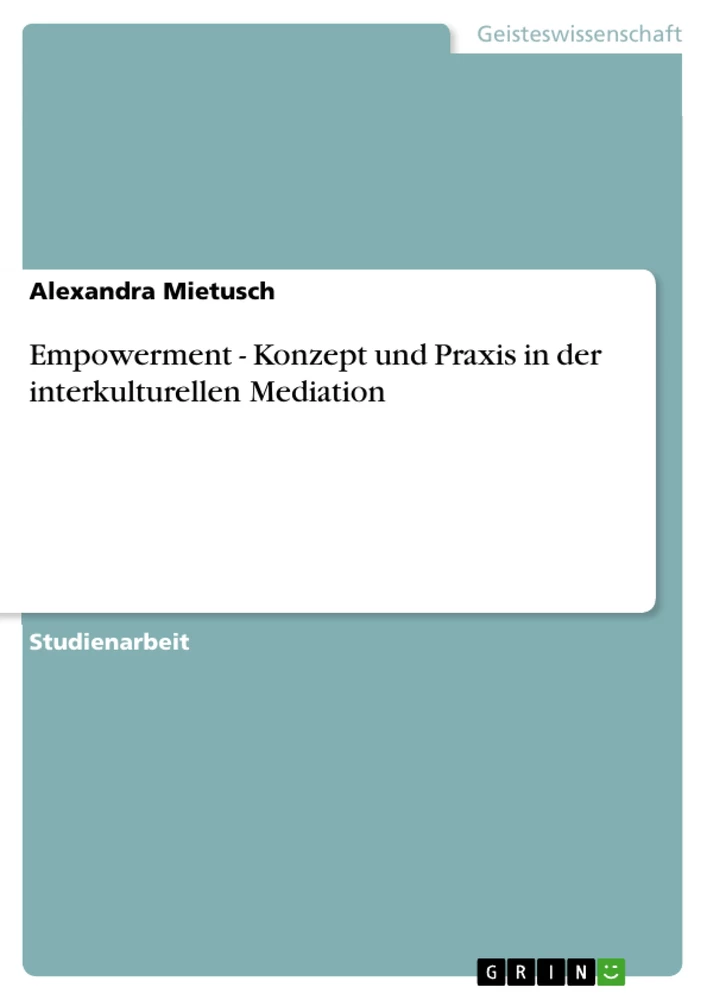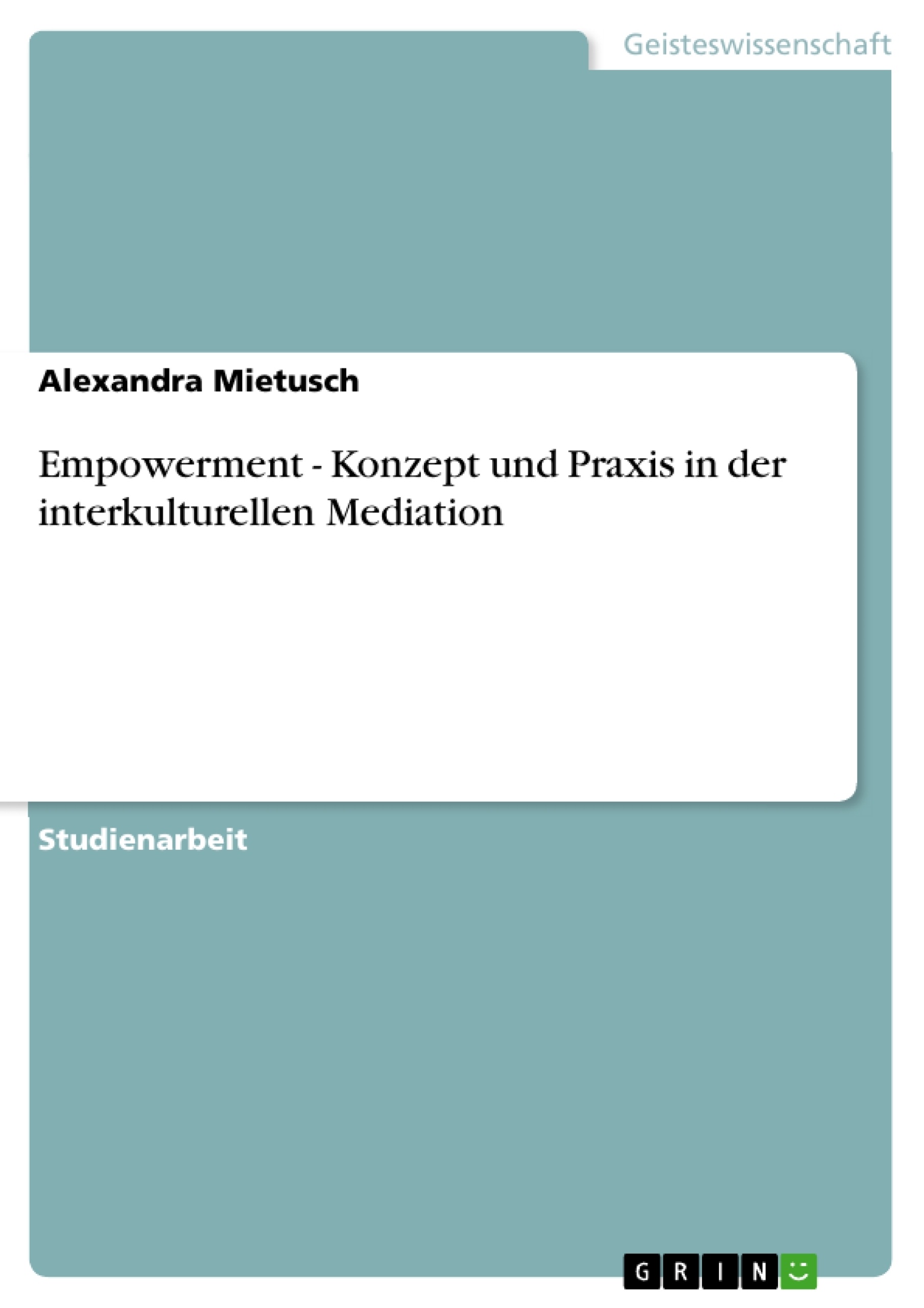Mit dem Werk Autoren Robert A. Baruch Bush und Joseph P. Folger (1994) The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition gewann der transformative Mediationsansatz in der Mediationspraxis an Reputation und Relevanz. Die als Urheber dieses Ansatzes verstandenen Autoren kontrastieren in ihrer Publikation die problem solving und transformative Mediationsansätze. Transformative Mediation stellt den Menschen und seine Bedürfnisse wie Gefühle in den Mittelpunkt. Zentral ist die Annahme, dass sich Menschen inmitten eines Konfliktes transformieren können, sodass soziales Lernen möglich ist. Die Zielgrößen sind Empowerment und Recognition. Hingegen liegt beim problem-solving Ansatz der Fokus lediglich auf dem Finden einer gegenseitig akzeptablen Vereinbarung der unmittelbaren Auseinandersetzung.
Es werden die Grundlagen und die praktische Verwendung der Methode des Empowerment als klientenzentrierter Ansatz innerhalb interkultureller Konfliktbearbeitung im Sinne der interkulturellen Mediation diskutiert. Welche Ideologie und welches Konfliktverständnis liegen der Anwendung zu Grunde und resultieren in der praktischen Anwendung des Empowerment in der interkulturellen Mediation? Worauf basieren das implizite Konfliktverständnis und die Praktiken im Umgang mit Konflikten, die zu den Entwicklungen der Theorien und Praktiken des Empowerment und der interkulturellen Mediation führen? Im ersten Teil wird das Konzept Empowerment, seine historischen Ursprünge, Definitionsannäherungen und Grundlagen für professionelles Handeln analysiert. Im zweiten Teil wird durch eine Einführung in die interkulturelle Mediation auf den Einsatz von Empowerment innerhalb dieser hingearbeitet. Es soll geklärt werden, welches Konfliktverständnis der Mediation obliegt und welche Rolle Macht und das implizite Machtverständnis innerhalb interkultureller Konflikte spielt und die Methode Empowerment innerhalb dieser legitimiert.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Das Empowerment Konzept
1.1 Definition
1.2 Ideologische Ursprünge: Individualisierung und Empowerment
1.2.1 Menschenbild und Wertebasis
1.2.2 Konsequenzen für professionelles Handeln
2 Die interkulturelle Mediation
2.1 Definition
2.2 Kulturelle Konfliktorientierung innerhalb der Mediation
2.3 Kulturelle Machttheorie innerhalb der Mediation
2.4 Macht und Konflikt als westliches Konstrukt - alternative kulturspezifische Interpretationen
2.5 Diskussion des Empowerment in der - interkulturellen - Mediation
3 Resümee
Literaturverzeichnis
Eigenständigkeitserklärung