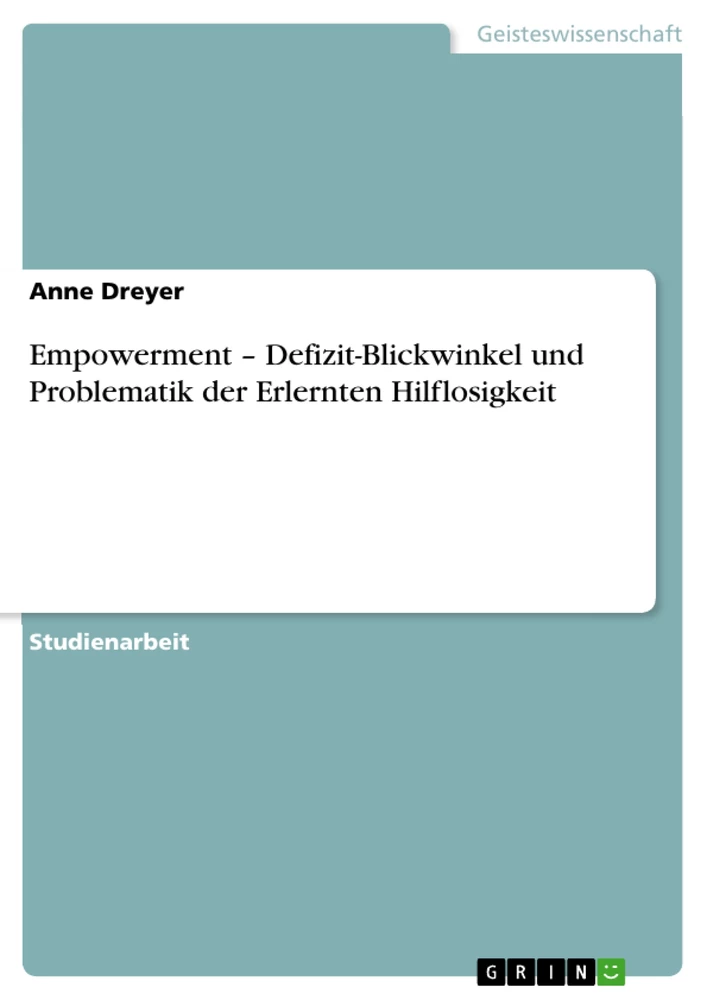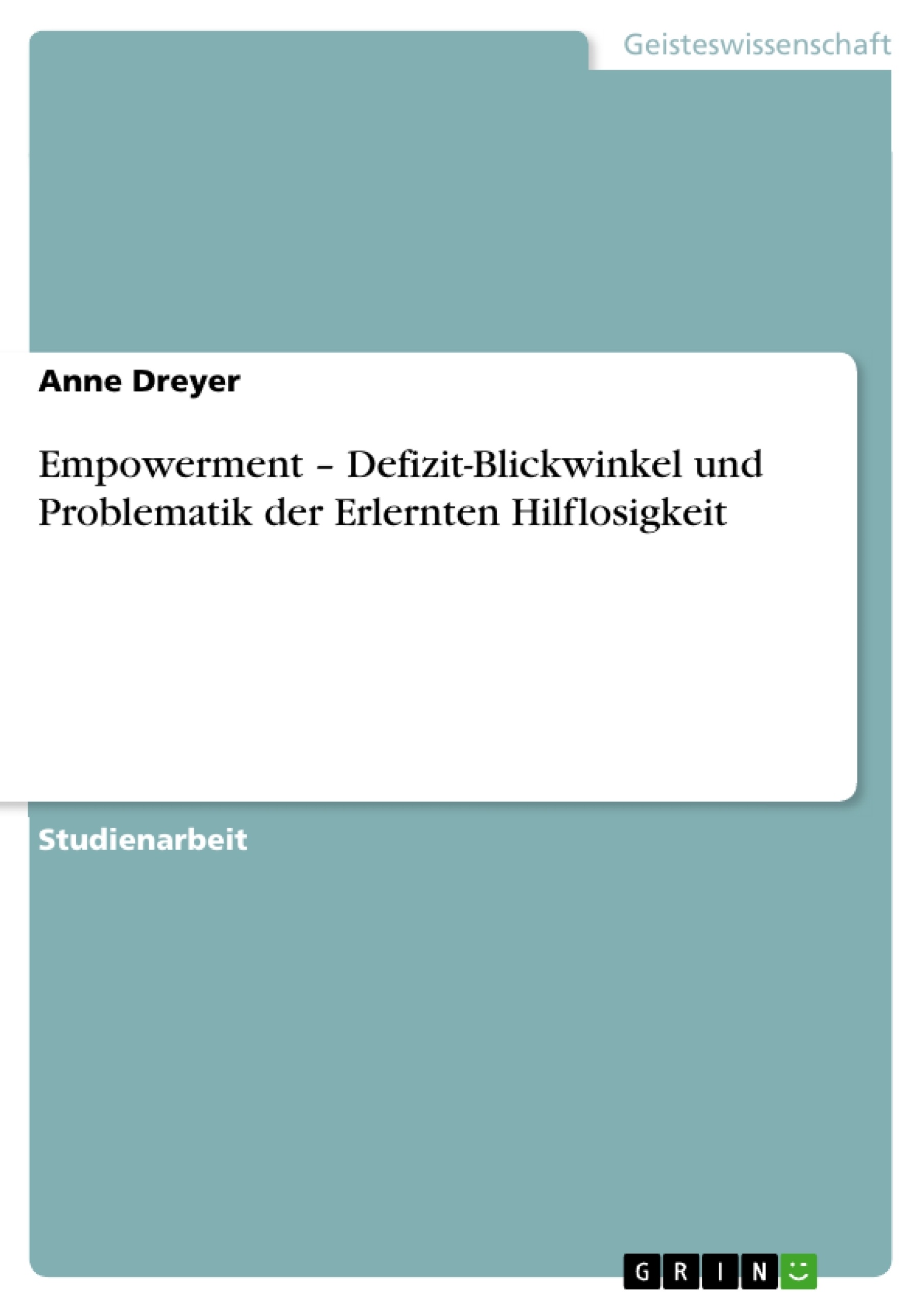Die folgende Arbeit befasst sich mit dem Empowerment-Konzept, dessen Ziel es ist, die Defizitfixierung durch eine Orientierung an den Stärken und Kompetenzen des Menschen zu ersetzen. Doch die Umsetzung dieser ressourcenorientierten Arbeitsweise erweist sich in der Praxis als äußerst heikel. Einer der vielen Stolpersteine des Empowerments ist der Defizit-Blickwinkel, der unter der Überschrift 2.3. genauer erläutert wird. Konzentriert man sich zu stark auf die Defizite, ist der Klient schnell entmutigt, verfällt eventuell sogar in die erlernte Hilflosigkeit. Aufgezeigt wird in dieser Arbeit auch diese Problematik, die von Martin Seligman als „Learned Helplessness“ definiert wurde. Ignoriert man die Defizite jedoch vollkommen, fühlt sich der Klient nicht ernst genommen. Wie hält der Sozialarbeiter die Balance auf diesem Drahtseilakt? Folgend auf den theoretischen Part dieser Arbeit wird dieser Fragestellung ein positives Praxisbeispiel zuzuordnen. Dabei stieß man auf das Problem der Stigmatisierung, dass durch die mit Vorurteilen behaftete Gesellschaft zu einem Regress in die Erlernte Hilflosigkeit führen kann. Im Praxisbeispiel wird ebenfalls angeführt, wie ein junger Mann, der an einer rheumatischen Krankheit leidet durch die Unterstützung seiner Familie dieser Hilflosigkeit, die durch professionelle Sozialpädagogen entstanden ist, entfliehen konnte.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Empowerment
2.1. Begriffserklärung
2.2. Stolpersteine
2.3. Defizit-Blickwinkel
3. Erlernte Hilflosigkeit
3.1. Begriffserklärung
3.2. „Learned Helplessness-Experiment“
4. Praxisbeispiel