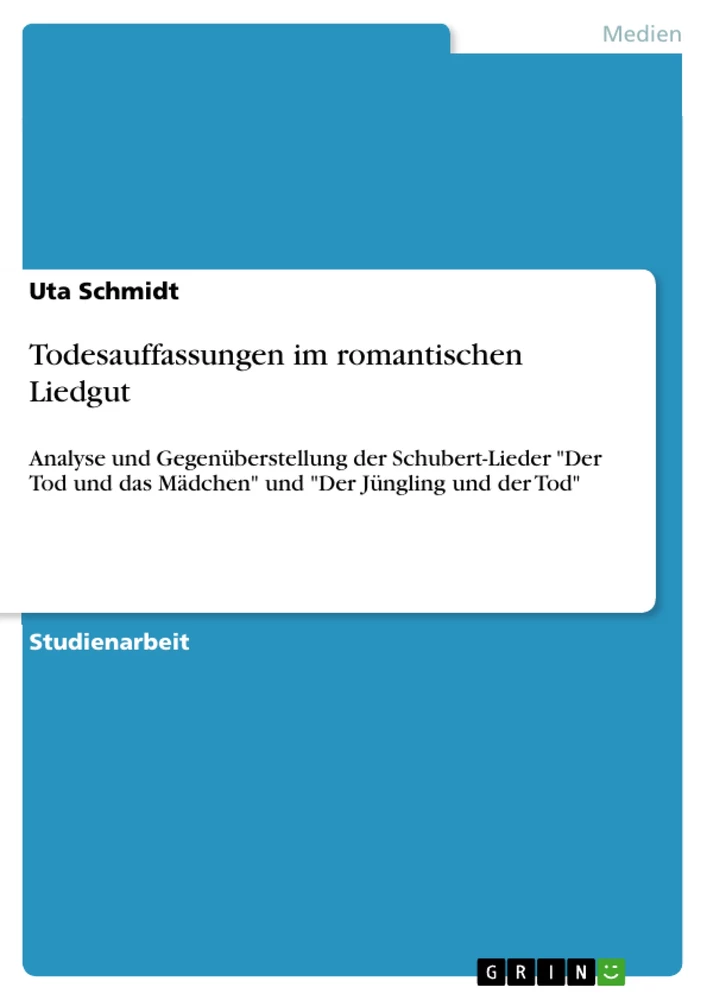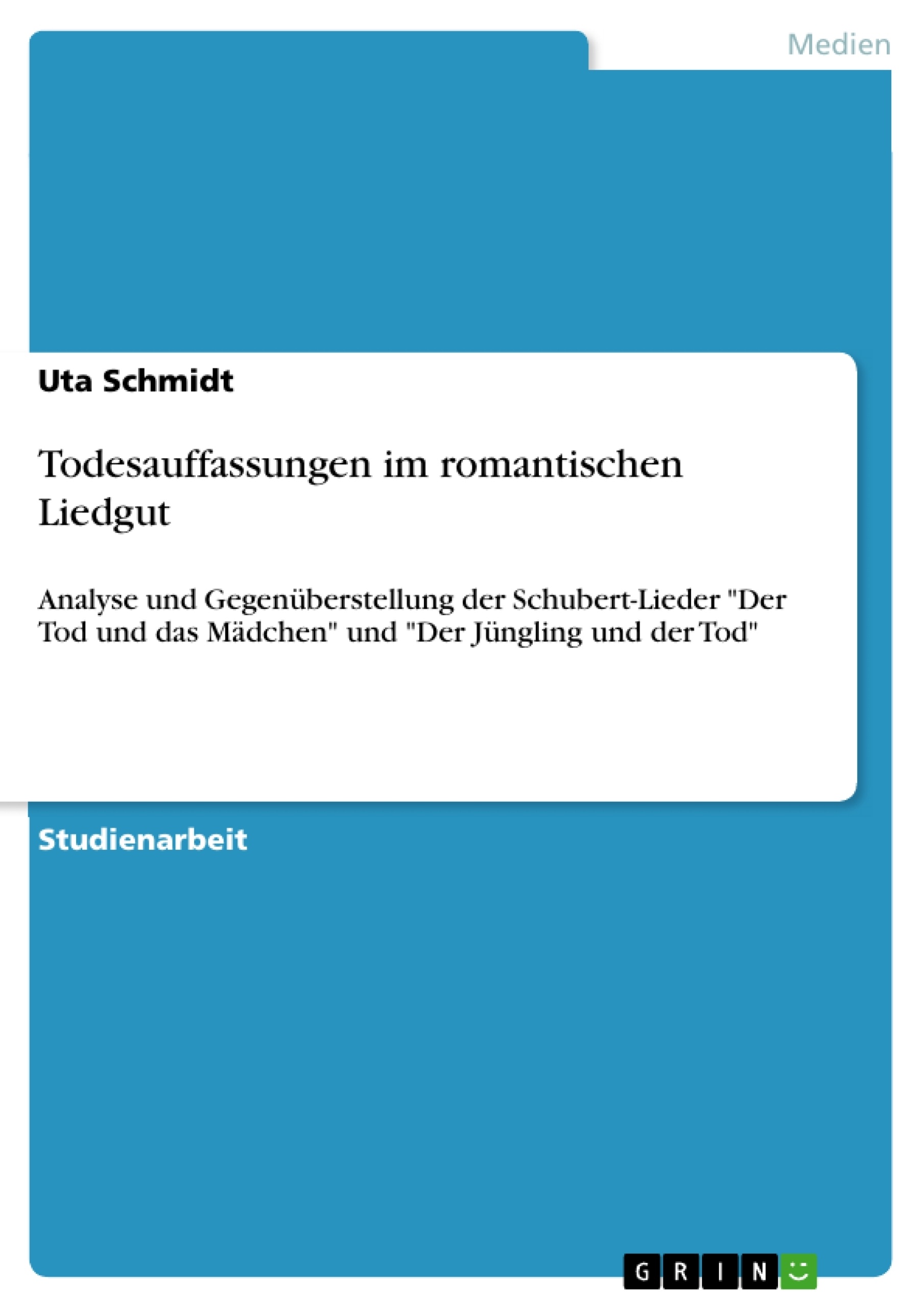Besonders im Zeitalter der Romantik, das so oft mit Schlagworten wie Emotionalität, Subjektivität, Isolation des Individuums und dem Wunsch nach Selbsterfahrung in Verbindung gebracht wird, haben sich etliche Liedkomponisten mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit auseinandergesetzt. Johannes Brahms und Gustav Mahler sind zwei der Hauptvertreter dieses Genres – ein Komponist, der insbesondere für sein Liedschaffen bekannt und berühmt geworden ist, war jedoch Franz Schubert. Mit einem der bedeutendsten seiner Werke, die sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen, dem Klavierlied „Der Tod und das Mädchen“, werde ich mich im Folgenden beschäftigen.
Anhand einer eingehenden Analyse und anschließender Gegenüberstellung mit dem wenig später komponierten Lied „Der Jüngling und der Tod“ möchte ich mich mit der Frage befassen, inwiefern die Musik hier einen Zugang zur Todesproblematik aufzeigt und wie Schubert damit verknüpft werden kann. Nicht nur die Einstellung Schuberts zum Thema des Todes, sondern auch die Aussagen der Gedichtvorlagen und der Zusammenhang beider Kompositionen bzw. Gedichte werden hierbei eine wichtige Rolle spielen. Abschließend hoffe ich, eine vage Antwort auf die Frage zu erhalten, ob und inwiefern es möglich ist, auch mit musikalischen Mitteln eine annähernd so verständliche Aussage zu formulieren, die uns Text und Bild tagtäglich vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Kapitel I: „Der Tod und das Mädchen“
1. Entstehung – Historischer Kontext
2. Gedichtinterpretation
3. Liedinterpretation
4. Schuberts Interpretation des Gedichts
Kapitel II: „Der Jüngling und der Tod“
1. Entstehung
2. Gedichtinterpretation
3. Liedinterpretation
4. Schuberts Interpretation des Gedichts
Kapitel III: Gegenüberstellung
1. Musikalische Berührungspunkte
2. Tonartencharakteristik
3. Auffälligkeiten bei den Todesstrophen
Zusammenfassung
Quellenangaben
Notenbeispiele:
Anlage 1: „Der Tod und das Mädchen“
Anlage 2: „Der Jüngling und der Tod“