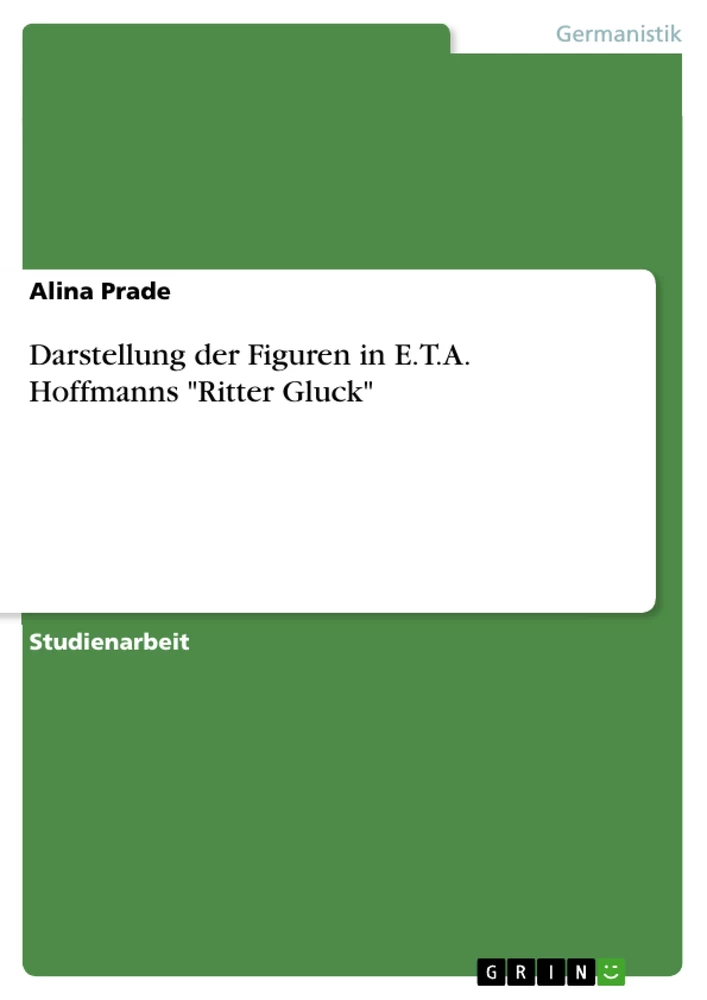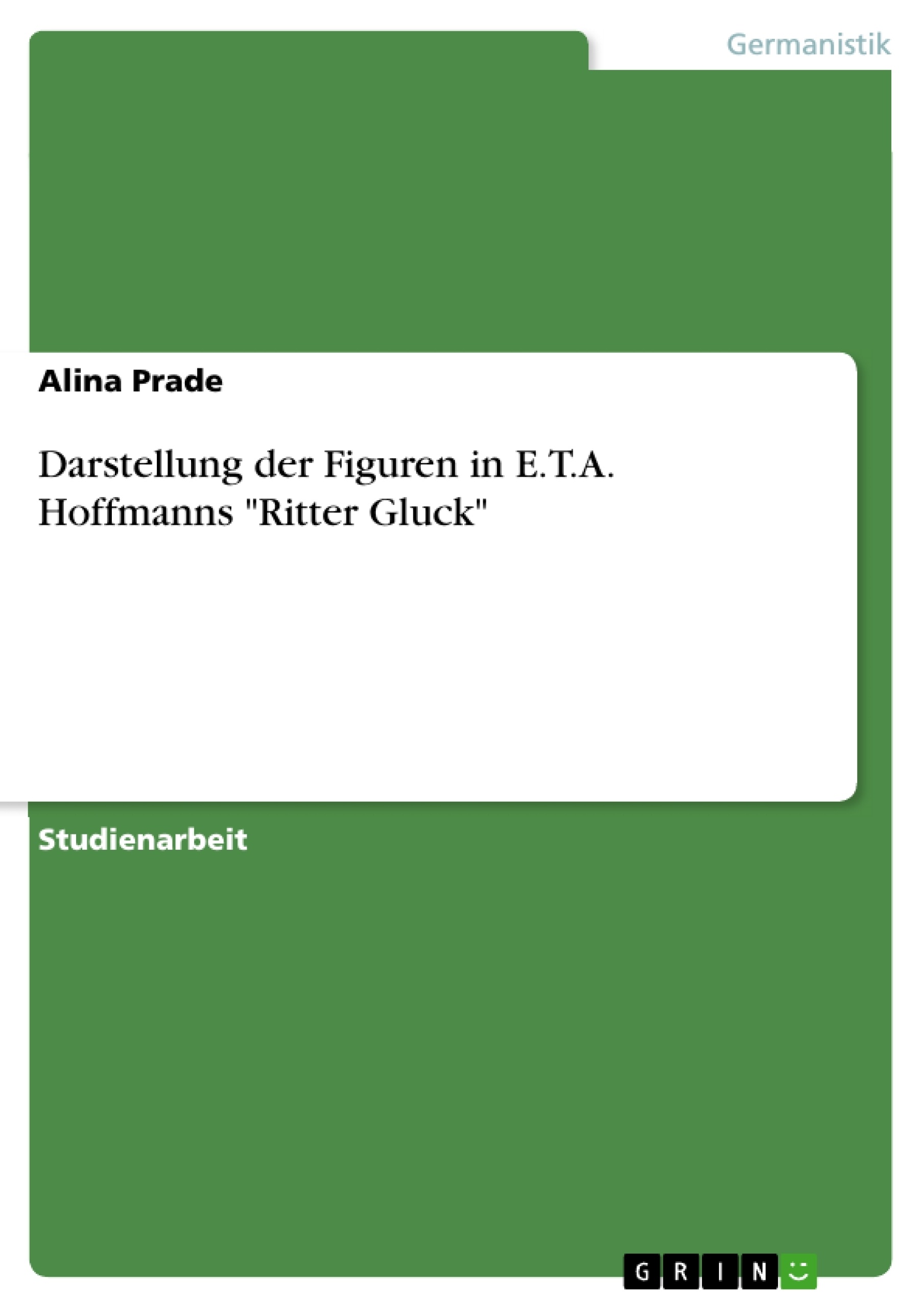Das Werk von E.T.A. Hoffmann, Ritter Gluck hat im Mittelpunkt die Figur eines Künstlers, die aber an die Grenze zwischen Realität und Phantasie dargestellt wird. Der Leser selber kann schwer zwischen die zwei Welten unterscheiden. Hoffmann benutzt eine historische Figur, als Hintergrund seines Werkes, um eine neue, geheimnisvolle Figur zu konstruieren und wiederzugeben. Diese Figur wird aber nur durch den Augen des Ich-Erzählers dargestellt und nur im Zusammenhang mit dem Erzähler, und das lässt den Leser mehrere Interpretationsmöglichkeiten offen.
Diese Arbeit konzentriert sich genau auf die Figuren und versucht, die wichtigsten Elemente herauszuarbeiten und zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entstehung
3. Ritter Gluck, die historische Figur
4. Literarische Figuren
4.1 Der Ich Erzähler
4.2 Ritter Gluck als literarische Figur
5. Wer ist „Ritter Gluck”?
5.1 Der Unbekannter als Wahnsinniger
5.2 Der Fremde als Geist der verstorbenen Ritter Gluck
5.3 Der Fremde als Phantasiegestalt
6. Schlussbemerkung
7. Bibliographie: