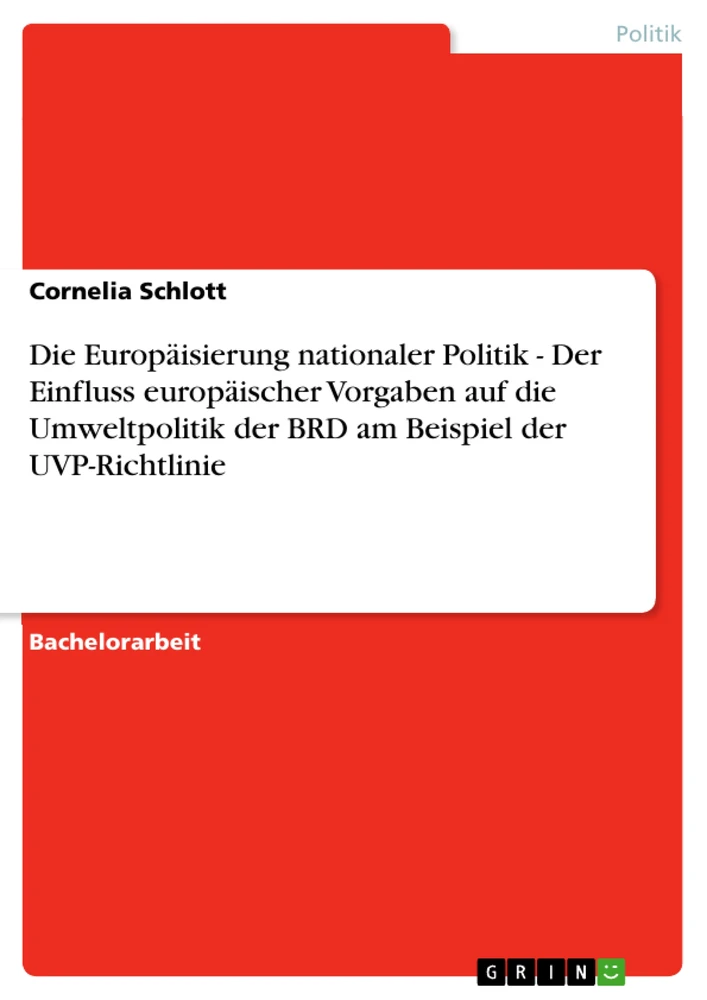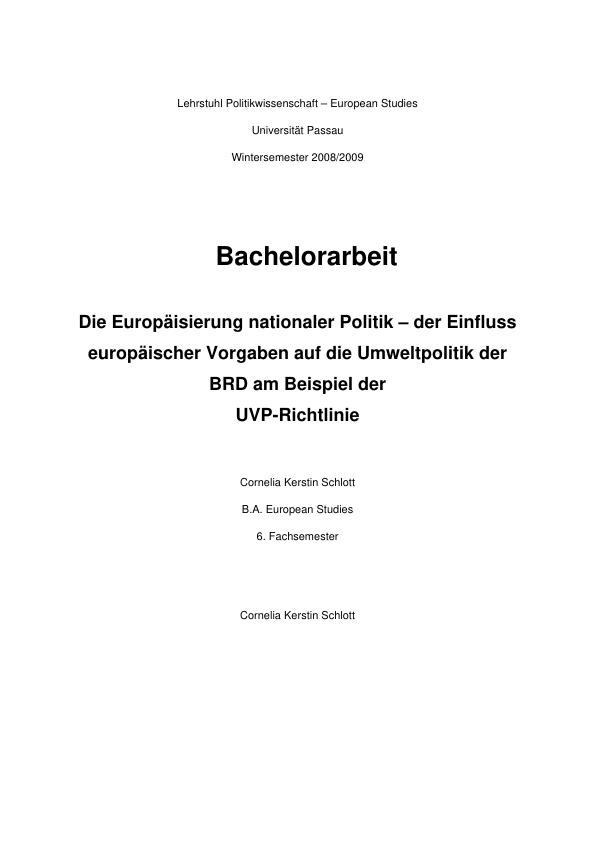Die voranschreitende europäische Integration stand Lange Zeit im Zentrum von Untersuchungsarbeiten, bis zunehmend der Begriff Europäisierung thematisiert wurde. Der Prozess der Europäisierung hat auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen. Die BRD, eingebettet in einem vielschichtigen Institutionensystem, blickt auf eine langjährige Geschichte europäischer Zusammenarbeit zurück und musste ihre nationale Politik, z. B. im Bereich der Umweltpolitik, oft an europäische Vorgaben angleichen. Doch was bedeutet Europäisierung eigentlich? Was geschieht, wenn europäische Vorgaben auf die nationale Ebene zurückwirken? Inwiefern und wodurch verändern diese Vorgaben die nationale Politik?
Ausgehend von der Hyphothese, dass europäische Vorgaben nationale Politik verändern, sollen am Beispiel der Umweltpolitik die Rückwirkungen der Europäisierung auf die nationale Ebene anhand einer konkreten europäischen Vorgabe gezeigt werden. Auf der Basis verschiedener Defintionen und Erklärungsansätzen zur Europäisierung, sollen die Veränderungen in der BRD, ausgelöst durch die Implementation der UVP-Richtlinie, untersucht werden. Die Wirkungsweise der Richtlinie und die nationalen Auswirkungen bilden hierbei das Kernstück der folgenden Analyse. Auch der historische Kontext, die Bedingungen für einen Wandel und die Fragen danach, ob oder inwiefern tatsächlich eine Veränderung stattgefunden hat, werden hierbei berücksichtigt.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. KONZEPTE DER EUROPÄISIERUNG
2.1. Gegenstandsbereich und Definitionsfindung der Europäisierung
2.2. Relevante Erklärungsansätze der Europäisierung
2.2.1. Die Europäisierung durch Vorgabe institutioneller Modelle
2.2.1.1. Wirkungsweise europäischer Politik
2.2.1.2. Nationale Auswirkungen europäischer Politik
2.3. Bewertung der Europäisierungskonzepte im Bezug zum Untersuchungsgegenstand der Arbeit
3. METHODIK
4. DIE EUROPÄISIERUNG DER UMWELTPOLITIK AM BEISPIEL DER IMPLEMENTIERUNG DER UVP-RICHTLINIE IN DEUTSCHLAND
4.1. Definition, Prinzipien und Instrumente der Umweltpolitik
4.2. Historische Perspektive - Die Entwicklung der deutschen und europäischen Umweltpolitik
4.3. Fallbeispiel: Die UVP Richtlinie
4.3.1. Inhalt, Zielsetzung und Rechtsgrundlage der UVP
4.3.2. Entstehung der UVP-Richtlinie und ihre Weiterentwicklung
4.3.3. Die Wirkungsweise der UVP-Richtlinie - ihre Implementation in der BRD und die damit einhergehenden Probleme
4.3.4. Nationale Auswirkungen - Veränderungen durch die UVP in der BRD
4.3.5. Kritische Würdigung der UVP-Richtlinie
5. FAZIT
6. LITERATURVERZEICHNIS