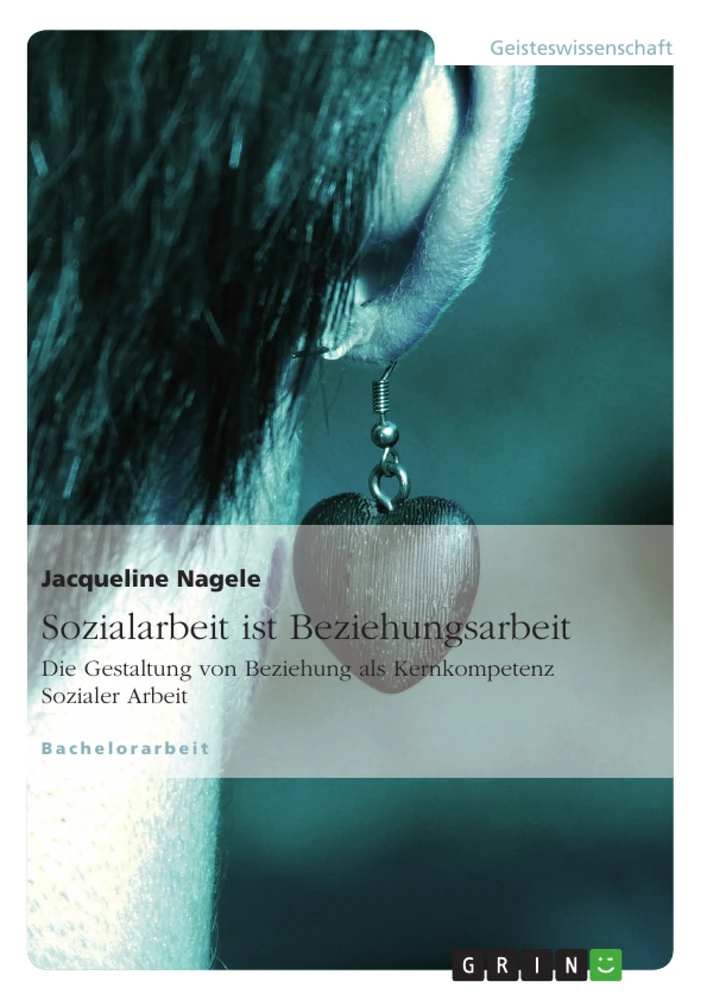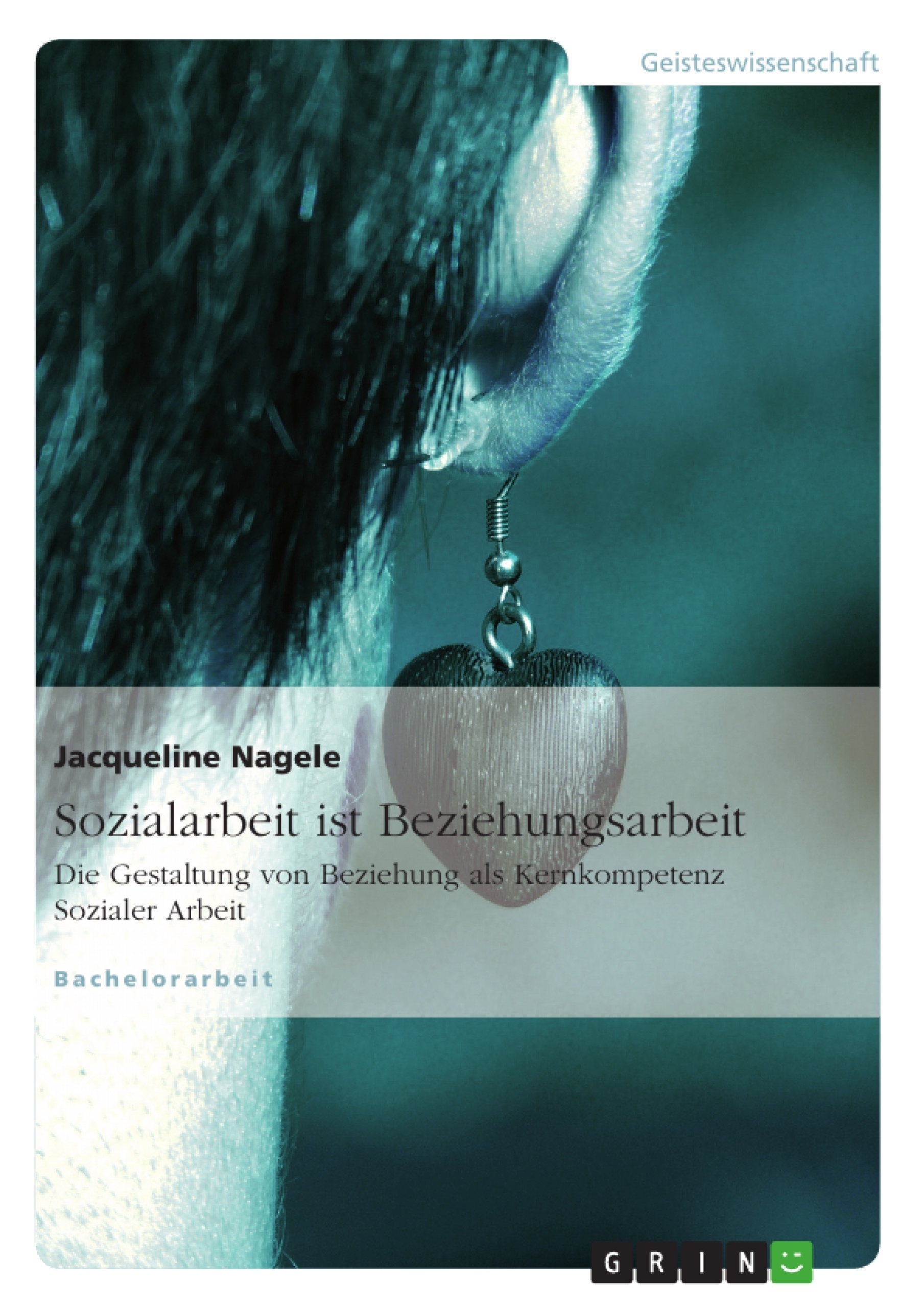Ohne eine tragfähige Beziehung zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn ist eine inhaltliche Arbeit in der Sozialen Arbeit nicht möglich. Professionelle Arbeitsbeziehungen bilden insofern Grundlage und Voraussetzung dafür, was auf die Bedeutsamkeit der Beziehungsgestaltung verweist.
Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, eine Antwort auf die erkenntnisleitende Fragestellung, wie Beziehungen im Rahmen der Sozialen Arbeit bewusst gestaltet werden können, zu erhalten. Die methodische Vorgangsweise beinhaltete die theoretische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theorien und Ansätzen, die zur Förderung der Beziehungsgestaltung beitragen sollen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Menschenbild und Haltung der SozialarbeiterInnen entscheidend zur Gestaltung von Beziehung beitragen. Ein beziehungsförderndes Menschenbild betrachtet den/die KlientIn als autonom und eigenständig, welche(r) ExpertIn für sein/ihr Leben und seine/ihre Probleme ist. Die Haltung der SozialarbeiterInnen gegenüber den KlientInnen sollte von Wertschätzung, Akzeptanz, Authentizität und Empathie gestützt werden. Weiters wirken sich die Beachtung der Grundregeln der Kommunikation und das Verwenden von Fragetechniken, welche sich auf die Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken der KlientInnen beziehen, positiv auf die Beziehungsgestaltung aus.
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Schlüsselbegriffe
Abstract
Keywords
1. Einleitung
2. Die professionelle Arbeitsbeziehung
2.1 Pädagogisches Handeln in Arbeitsbeziehungen
2.2 Abgrenzung der persönlichen Beziehung von der professionellen Beziehung
2.3 Das Professionelle Arbeitsbündnis als ein Aspekt der Arbeitsbeziehung
3. Die Gestaltung von Beziehung aus systemtheoretischer Perspektive
3.1 Haltungen und Grundprinzipien des systemischen Ansatzes
3.2 Vorgehensweisen und Techniken des systemischen Ansatzes
4. Kommunikation als tragendes Element der Beziehungsgestaltung
4.1 Axiome menschlicher Kommunikation
4.1.1 Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
4.1.2 Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
4.1.3 Die Interpunktion von Ereignisfolgen
4.1.4 Analoge und digitale Kommunikation
4.1.5 Symmetrische und komplementäre Interaktionen
4.2 Störmomente der Kommunikation
4.2.1 Störungen auf dem Gebiet der Inhalts- und Beziehungsaspekte
4.2.2 Störungen in symmetrischen und komplementären Interaktionen
5. Die zwischenmenschliche Beziehung nach Rogers
5.1 Elemente wachstumsfördernder Beziehung
5.1.1 Kongruenz
5.1.2 Empathie
5.1.3 Wertschätzung oder positive Zuwendung
5.1.4 Das bedingungsfreie Akzeptieren
5.1.5 Die Wahrnehmungswelt des Klienten
6. Grenzen und Ambivalenzen in der Gestaltung von Beziehung
6.1 Nähe und Distanz
6.2 Liebe - Vertrauen - Neugier
6.3 Der Aufbau eines professionellen Arbeitsbündnisses in Zwangskontexten
7. Resümee
Literaturverzeichnis
Internetquellen