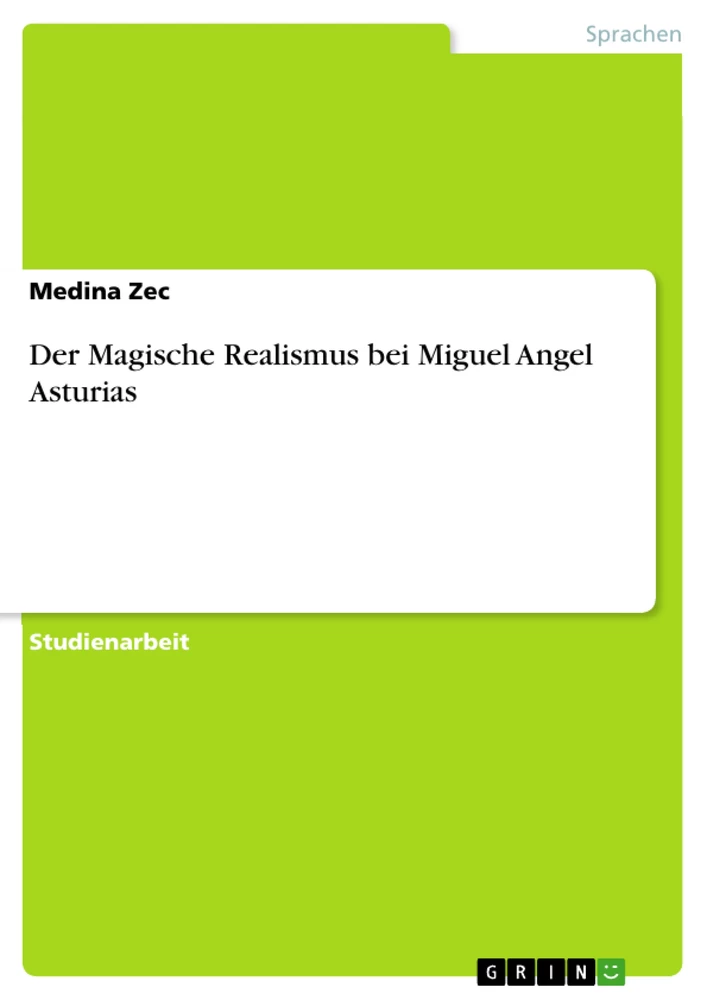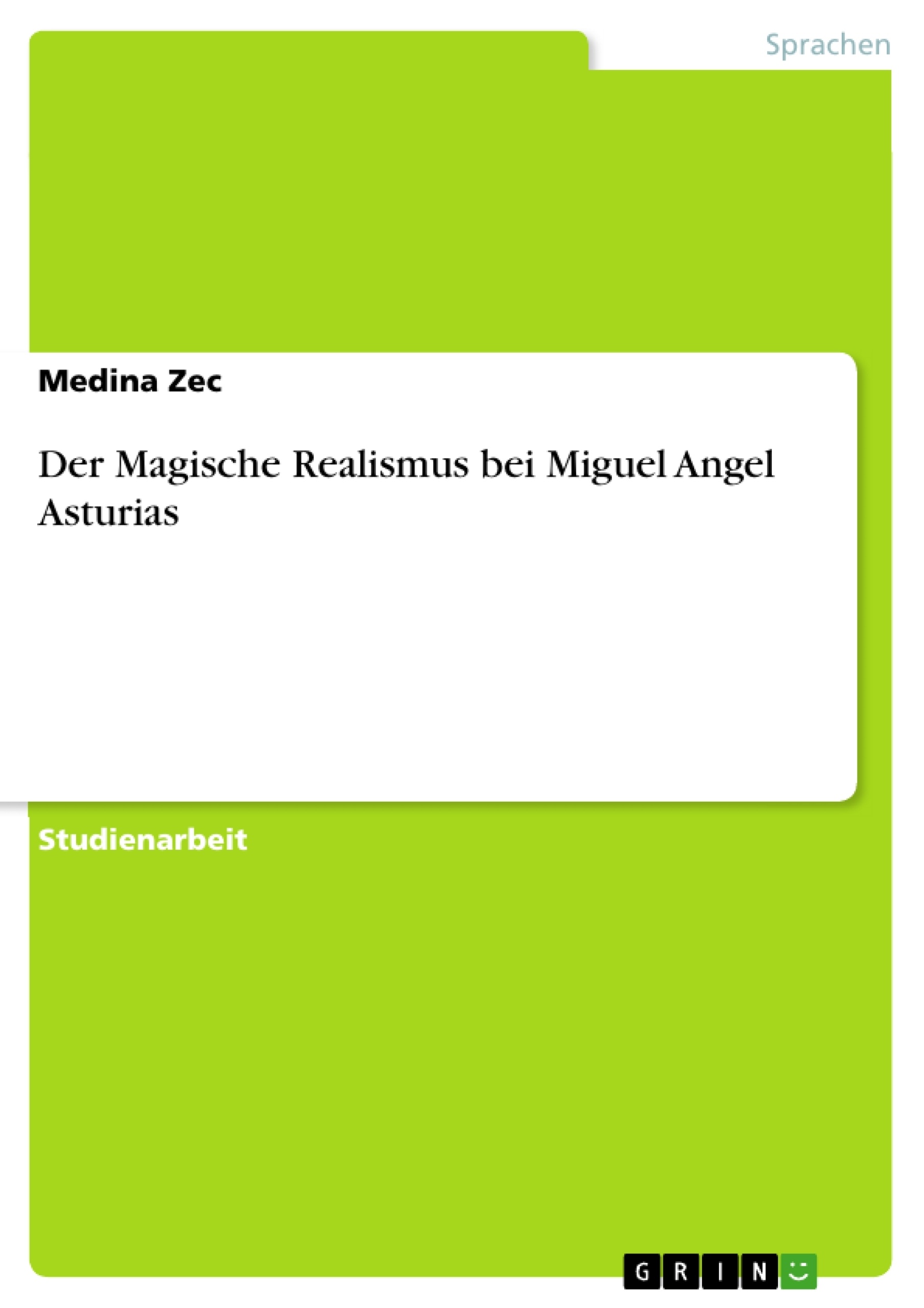Die Avantgarde in der lateinamerikanischen Literatur entfaltete sich erst in den letzten Jahrzehnten. Seit den siebziger Jahren versucht die Forschung ein Profil der Avantgarde Südamerikas herauszuarbeiten, mit dem Schwerpunkt auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. In den vierziger Jahren setzte das „neue Schreiben“ ein, die Nueva Novela, die zwei Jahrzehnte später zur „Boom-Literatur“ wurde. Die Neuerungen handelten von städtischen Lebensformen, existentiellen Fragestellungen und einer individuellen Weltsicht. Viele Innovationen gingen auf bekannte, moderne Techniken zurück. Europäische Strömungen, wie der Dadaismus und der Surrealismus, beeinflussten die lateinamerikanischen Avantgarde-bewegungen nachhaltig. Mitunter flossen Fragestellungen über die Existenz des Lebens, die Selbstfindung und auch die Absurdität in die literarischen Texte ein. Eine Richtung, die sich in Lateinamerika herausgebildet hatte, war die These der „wunderbaren Wirklichkeit“ von Alejo Carpentier, oder dem „Magischen Realismus“ von Miguel Ángel Asturias. Diese Neuerungen waren Ausdruck einer entscheidenden Entwicklung in Südamerika.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die europäische Avantgardebewegung
3 Der Ursprung des Surrealismus
4 Der Surrealismus in Lateinamerika
5 Der Magische Realismus
6 Das neue Selbstwertgefühl Lateinamerikas
7 Miguel Ángel Asturias und sein Schaffen
7.1 Asturias und der Surrealismus
7.2 Asturias Werk “Leyendas de Guatemala”
7.2.1 Analyse zum Werk „Leyendas de Guatemala“
7.3 Asturias Werk “El Señor Presidente
7.3.1 Analyse zum Werk „El Señor Presidente“
7.4 Vergleich zu den Analysen
8 Schlusswort
9 Quellen