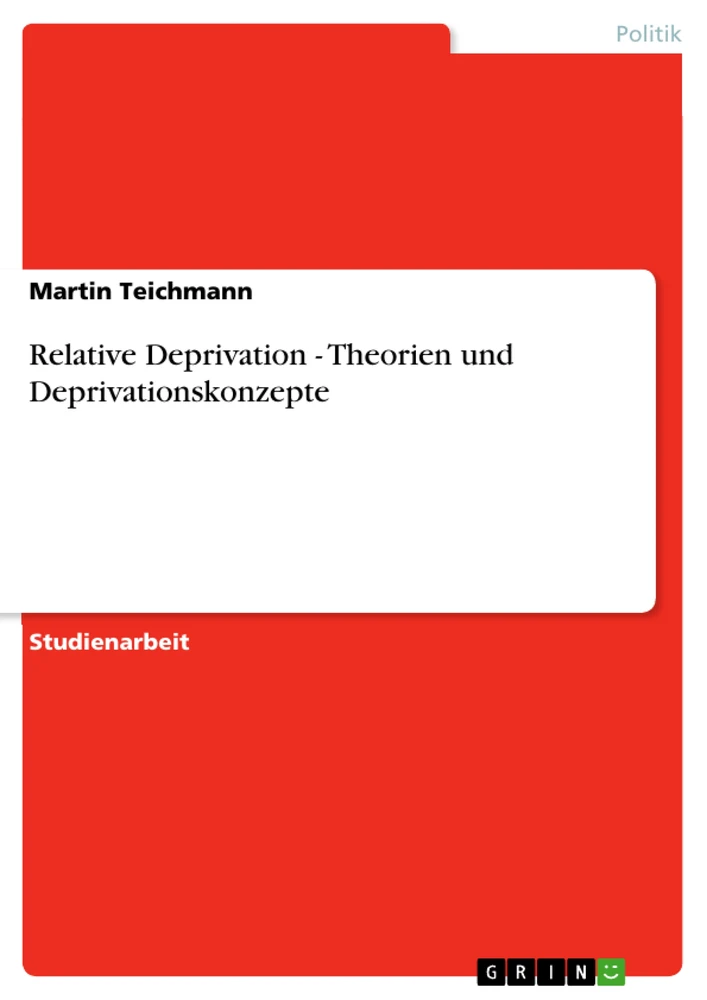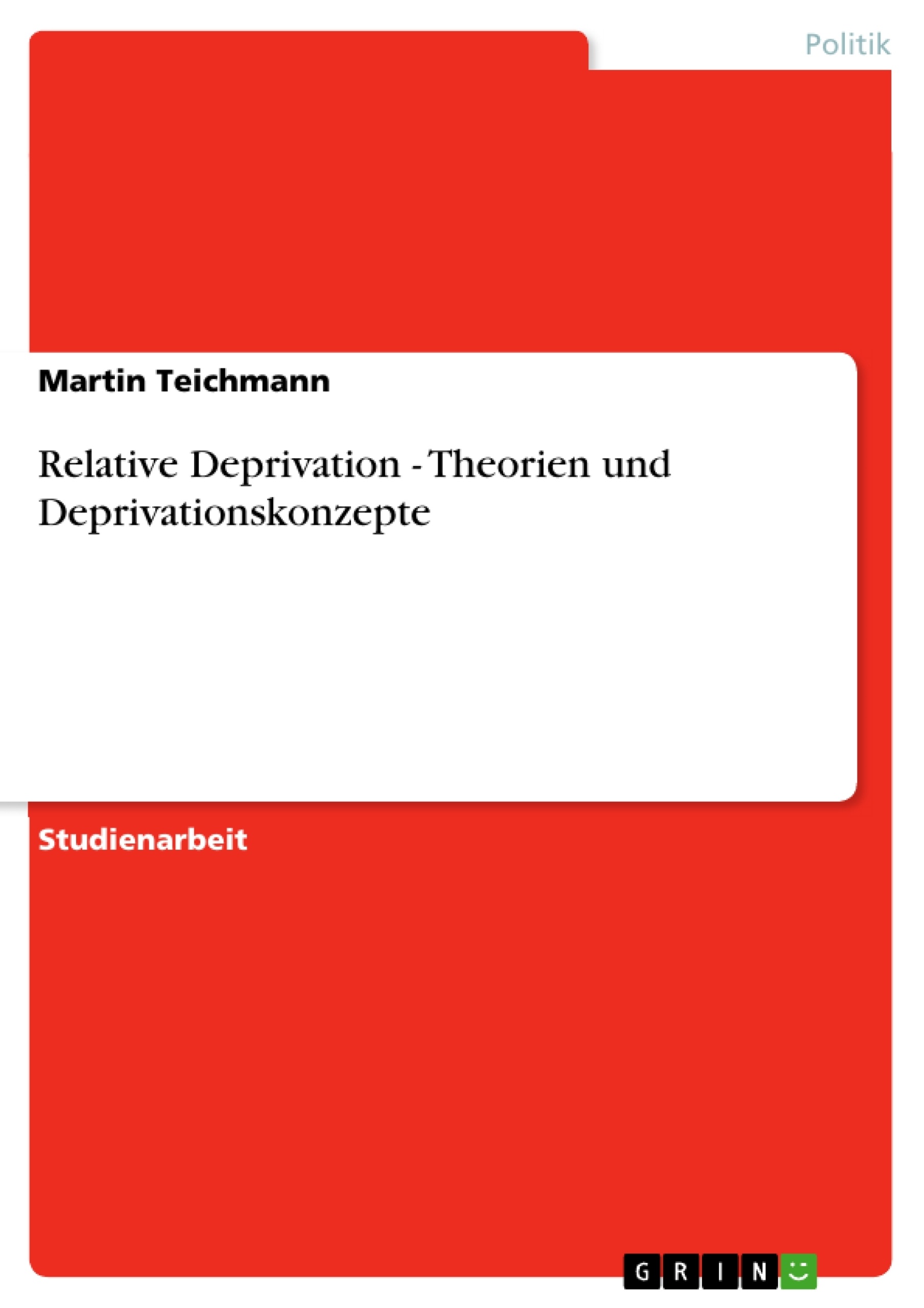Die Erforschung der Ursachen für Fremdenfeindlichkeit ist ein weitläufiges Feld, auf dem es zahlreiche Theorien und Untersuchungen gibt. Letztere weisen einen Zusammenhang zwischen dem sozialen-, bzw. ökonomischen Ungleichgewicht (oder auch mehreren Ungleich-gewichten) und der Fremdenfeindlichkeit auf. Die theoretischen Verbindungen liegen gerade hierbei in der Sündenbock-, als auch der Deprivationstheorie, wobei sich beide Theorien sehr ähneln und gemeinsame Komponenten besitzen. In der vorliegenden Ausarbeitung werde ich mich mit der Thematik der Relativen Deprivation befassen.
[...]
Danach möchte ich die im Lehrforschungsprojekt I / II ausgearbeitete und durchgeführte „Marburger Studie 2005“ (s. Literaturliste) mit deren Kernthematik und eigentlichen Forschungszielen vorstellen. Im Anschluss folgt eine von mir aufgestellte Hypothese, welcher die vorgestellten Theorien der relativen Deprivation in Bezug auf die „Marburger Studie 2005“ zu Grunde liegen. Diesbezüglich habe ich die Ergebnisse der Studie mit Hilfe des Programms SPSS ausgewertet und auf die Gültigkeit meiner Hypothese hin untersucht
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorien der relativen Deprivation
3. Verschiedene Deprivationskonzepte
3.1 Konzept von Andreas Zick
3.2 Konzept von W.G. Runciman
3.3 Konzept von Ted Gurr
3.4 Modelle der relativen Deprivation nach Ted Gurr
4. Resümee und Kritik an Deprivationskonzepten
5. Operationalisierung
5.1 Vorstellung der „Marburger Studie 2005“
5.2 Auswertung in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und relativer Deprivation
5.3 Vorstellung und Überprüfung der Hypothese
6. Fazit
7. Literaturliste und Quellenangaben