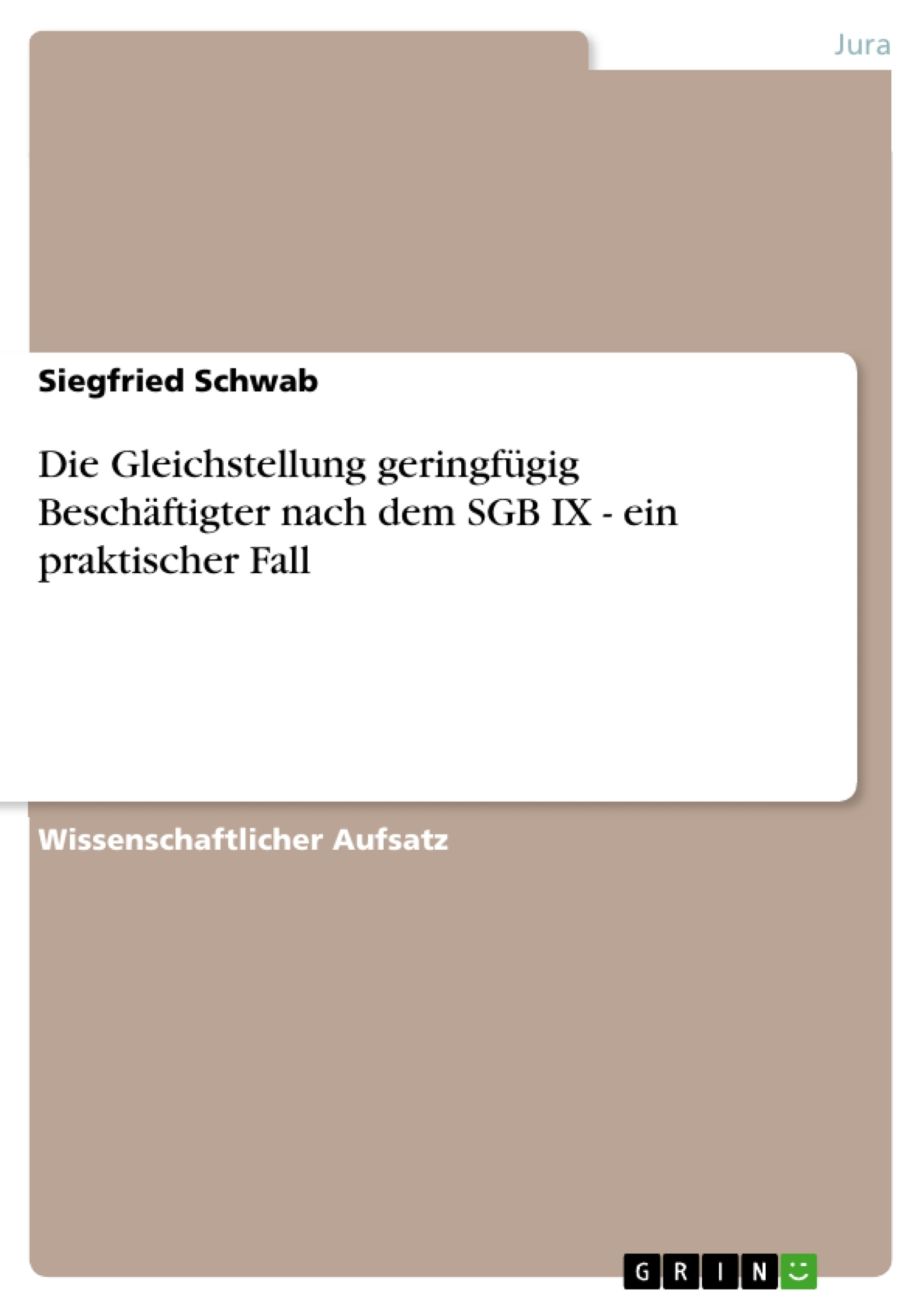Eine Gleichstellung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes soll erfolgen, wenn der Betreffende infolge seiner Behinderungen bei wertender Betrachtung (i. S. einer wesentlichen Bedingung) in seiner Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Nichtbehinderten in besonderer Weise beeinträchtigt und deshalb nur schwer vermittelbar ist. Unter dieser Voraussetzung ist eine Gleichstellung zur Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes gerechtfertigt, denn die Gleichstellung hat zur Folge, dass der Gleichgestellte auf die Pflichtquote (§ 71) des ArbG angerechnet wird. Die Gleichstellung kann dazu dienen, dem Minderbehinderten einen Arbeitsplatz zu verschaffen oder zu erhalten. Hintergrund der Gleichstellung ist die Tatsache, dass bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50 nicht automatisch eine uneingeschränkte Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt vorliegt. Eine Gleichstellung kommt in Betracht, wenn eine Schutzbedürftigkeit vorliegt, d. h. behinderte Mensch ansonsten nicht in der Lage ist, sich einen geeigneten Arbeitsplatz zu verschaffen oder zu erhalten. Jede Gleichstellung ist von drei persönlichen Voraussetzungen abhängig.
Der Gleichzustellende muss zum Personenkreis des § 2 Abs. 2 SGB IX gehören, also im Bundesgebiet rechtmäßig wohnen, sich aufhalten oder arbeiten.
Es muss eine Feststellung über den Grad der Behinderung nach § 69 SGB IX vorliegen.
Der Gleichzustellende muss sich ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht verschaffen oder erhalten können. Ob der Behinderte bereits in einem Betrieb als Arbeitnehmer tätig ist oder eine Beschäftigung erst aufnehmen will, ist nicht von Belang.
Die Auslegung und Anwendung des § 73 SGB IX durch die Arbeitsagentur verstößt gegen § 4 TzBfG. § 4 Abs. 1 TzBfG differenziert in der ab 01.04.1999 geltenden Fassung nicht zwischen teilzeitbeschäftigten und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. § 4 enthält ein Verbot der Diskriminierung: Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftiger Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Genau das passiert aber, wenn man wie die Arbeitsagentur § 73 SGB IX auf § 68 und das Gleichstellungsverfahren bezieht. Dies ist weder vom Gesetzgeber so gedacht, noch formuliert und erst recht gar nicht gewollt. Kapitel 2 (SGB IX) regelt die Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber.
Die Gleichstellung geringfügig Beschäftigter nach dem SGB IX - ein praktischer Fall
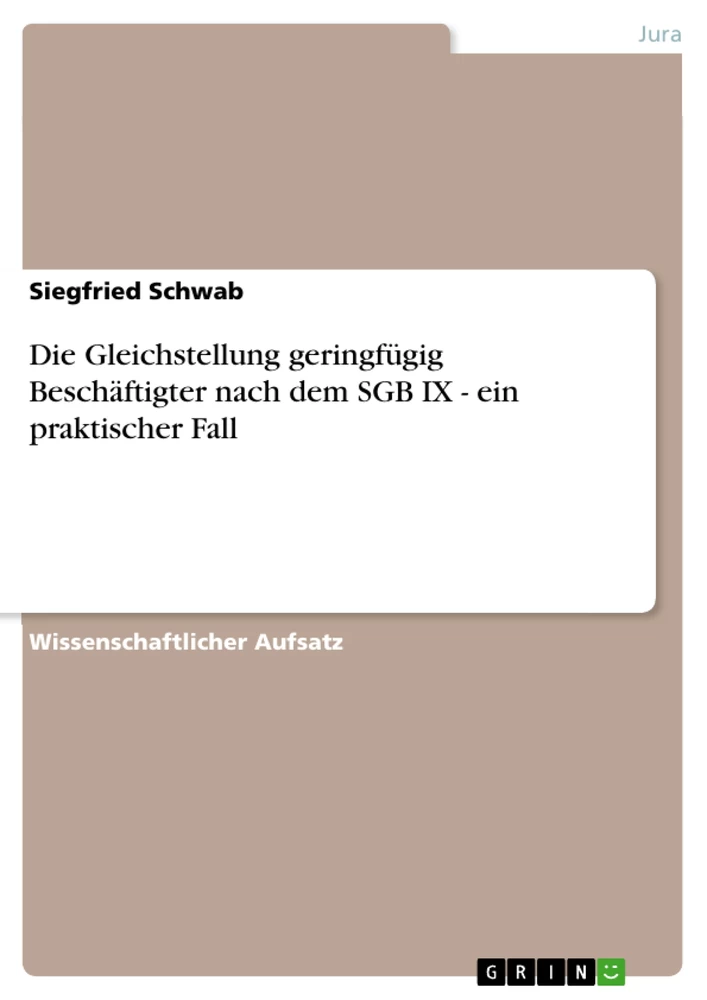
Wissenschaftlicher Aufsatz , 2010 , 7 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in)
Jura - Zivilrecht / Arbeitsrecht
Leseprobe & Details Blick ins Buch