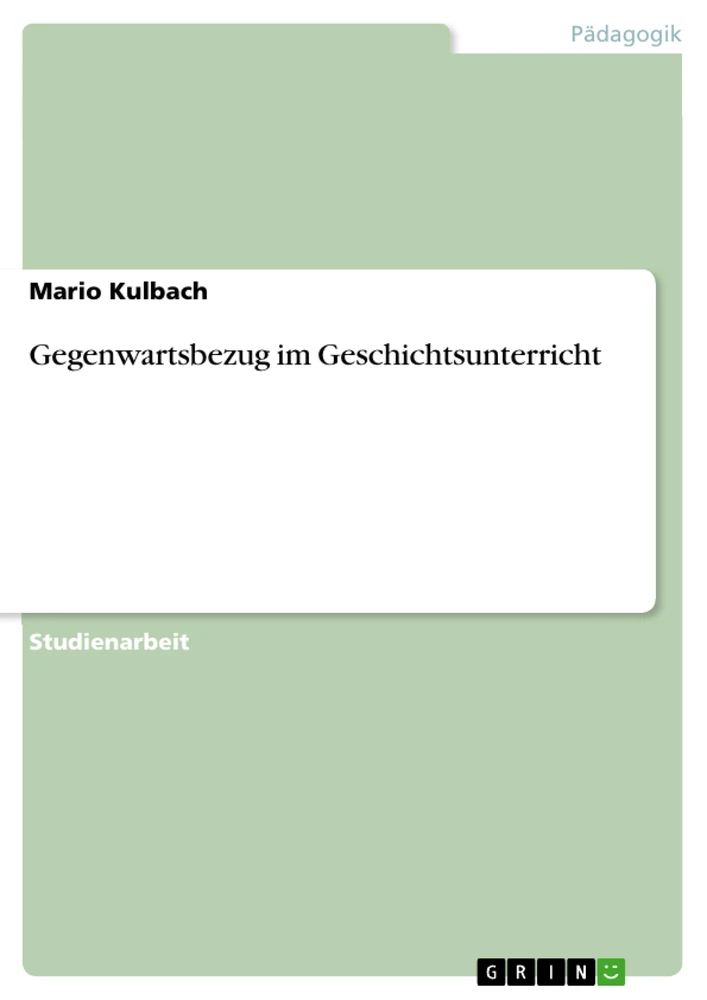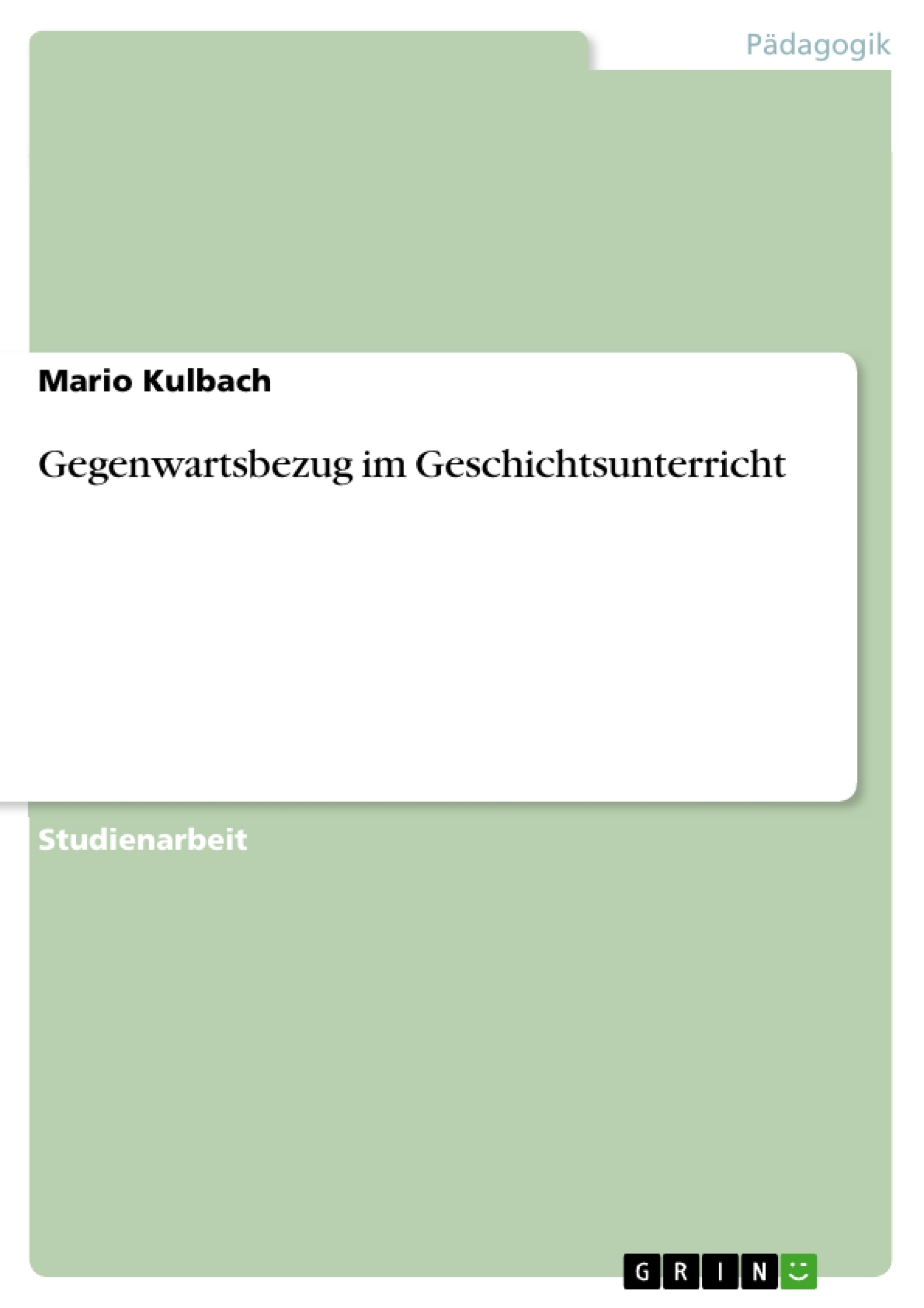In der vorliegenden Hausarbeit soll es um das Thema des Gegenwartsbezuges im Geschichtsunterricht gehen. Im Zentrum dieser Ausarbeitung steht die Frage, wo und welche Gegenwartsbezüge im Geschichtsunterricht integriert werden können. Grundlage dieser Arbeit sind die Forschungserkenntnisse von Klaus Bergmann (1938 – 2002), der sich u.a. schwerpunktmäßig mit einem gegenwartsbezogenen Geschichtsunterricht befasste. Trotz des Verweises auf Bergmann, werden an der einen oder anderen Stelle kritische Bemerkungen oder Ergänzungen zu dessen Ansichten hinzugefügt.
Die Beantwortung der oben gestellten Leitfrage geschieht in drei Schritten. Zunächst werden in einem ersten Abschnitt die theoretischen Grundlagen eines gegenwartsbezogenen Geschichtsunterrichtes beleuchtet, bevor im zweiten Teil der Hausarbeit auf konkrete Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart eingegangen wird. Dieser zweite Teil gliedert sich wiederum in drei Unterkapitel, nämlich a. Unmittelbare Gegenwartsbezüge, b. Gegenwartsbezüge als Ursachenzusammenhang und c. Gegenwartsbezüge als Sinnzusammenhang. Der Schwerpunkt in diesem zweiten Teil liegt auf Unterkapitel a., also den Unmittelbaren Gegenwartsbezügen. Anschließend werden in einem dritten Teil die Phasen von Unterricht dahingehend untersucht, ob und, wenn ja, wie Gegenwartsbezüge in diesen Phasen realisiert werden können. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
3. Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart
a. Unmittelbare Vergangenheitsbezüge
i. Allseitige Geschichtlichkeit
ii. Geschichtlichkeit von Begriffen
iii. Geschichte als politisches Argument
iv. Kalender-Geschichte(n)
v. Geschichte in der Werbung
vi. Straßennamen
vii. Denkmäler und Erinnerungstafeln
viii. Bauliche Überreste
ix. Oral history
x. Comics und Jugendbücher
xi. Ein neues Medium – Internet
b. Gegenwartsbezug als Ursachenzusammenhang
c. Gegenwartsbezug als Sinnzusammenhang
4. Phasen des Unterrichts
5. Fazit
6. Literatur
7. Erklärung