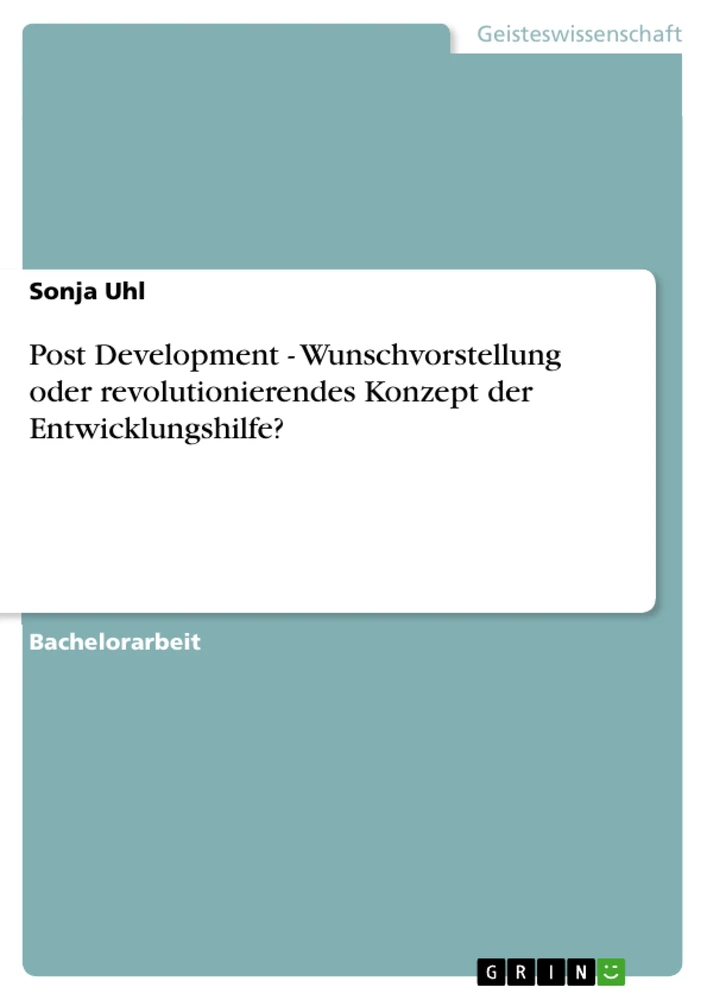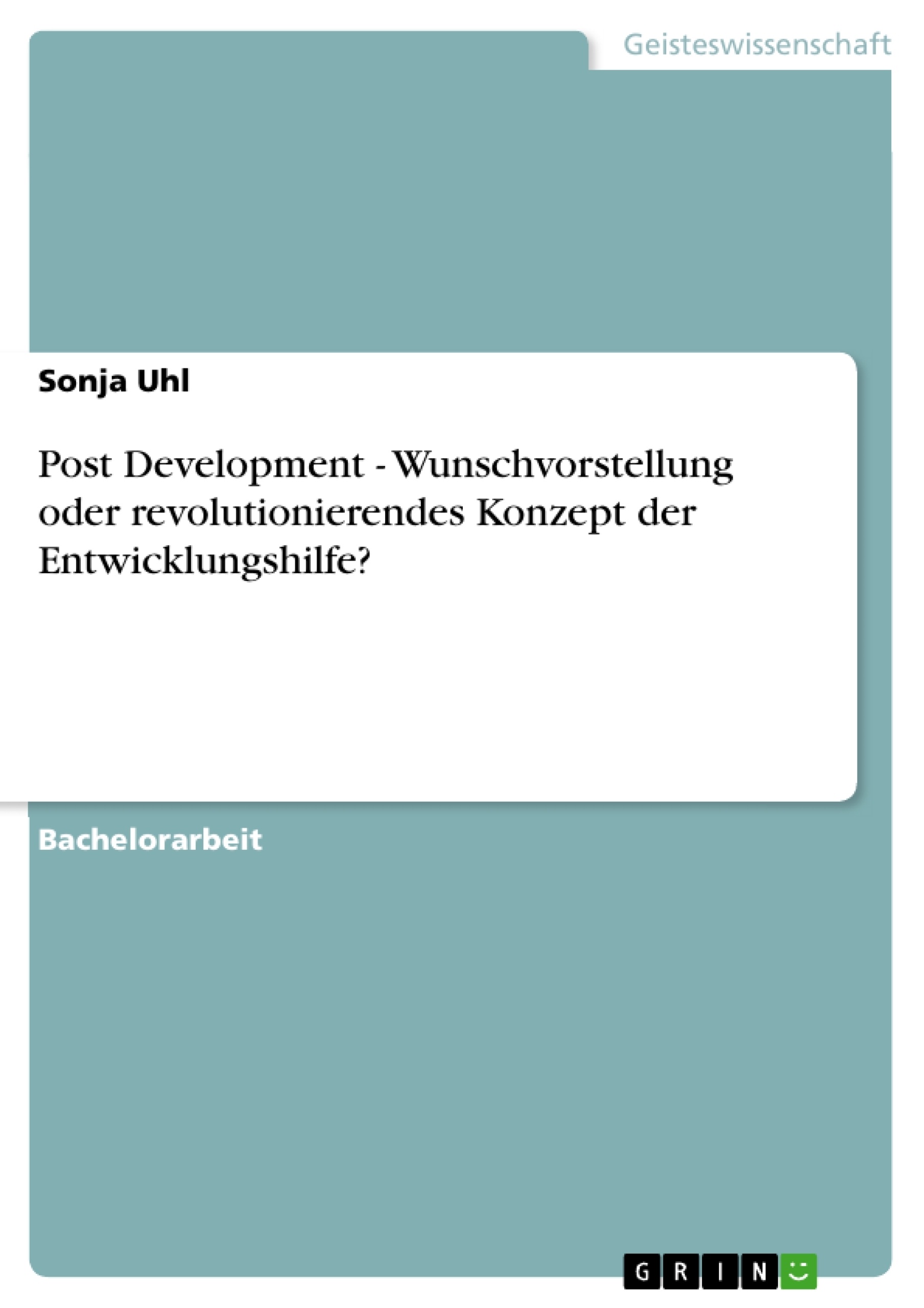I)Einleitung
Kaum eine politische Idee oder ein Ansatz ist von der Bevölkerung so positiv und mit Unterstützung aufgenommen worden wie Entwicklung. Als Präsident Truman seine Antrittsrede im Januar 1949 hielt und den Armen der Welt versprach, ihnen bei der Entwicklung zu Wohlstand zu helfen, wurde dies von der Bevölkerung im Westen sehr positiv aufgenommen. Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber auch heute noch löst der Begriff Entwicklung und Entwicklungshilfe bei einem Großteil der Bevölkerung positive Konnotationen aus. „No economic subject more quickly captured the attention of so many as the rescue of the people of the poor countries from their poverty.“1 Bei wissenschaftlicher Betrachtung des Sachverhaltes stellt sich dies jedoch als sehr verwunderlich dar, da die Zahl der Armen auf der Welt weder gesunken ist, noch sich eine deutliche Verbesserung durch milliardenschwere Entwicklungshilfe eingestellt hat. Ganz im Gegenteil: Heute leben mehr Menschen unter der Armutsgrenze als je zuvor, obwohl unzählige Entwicklungshilfeinterventionen durchgeführt wurden. Diese erzielten jedoch sehr oft nicht den gewünschten oder erdachten Erfolg. Seit den 80ger Jahren entwickelte sich dann eine breite Gegnerschaft der konventionellen Entwicklungskonzepte im Sinne von Interventionsprojekten zur Förderung von Modernisierung und kapitalistischer Ökonomie des Entwicklungslandes. Aus der Kritik des Entwicklungsgedankens entstand die Post-Development-These, man befinde sich „nach Entwicklung“. Post-Development Ansätze möchten zeigen, wie die dritte Welt seit der Nachkriegszeit systematisch durch den Entwicklungsdiskurs konstruiert wurde. Was kommt nach Entwicklung? Post-Development Vertreter dekonstruieren den Entwicklungsgedanken als Diskurs und möchten darstellen, wie eine Hilfe für die in Armut lebende Bevölkerung auf der Welt nach Entwicklung aussehen soll. Da diesen Thesen eine sehr starke theoretische Fundierung immanent ist, stellt sich die Frage, ob sie auch effizient auf die Praxis übertragen werden können. Dieser Fragestellung möchte ich in dieser Arbeit nachgehen und dabei die Effizienz die Wirkungsweisen des der Post-Development Ansätze erörtern.
Inhaltsverzeichnis
I) Einleitung
II) Entwicklung als Begriff
III) Überblick der Entwicklungsgeschichte
1. Modernisierungstheorien (50ger -60ger Jahre)
1.1 Hauptthesen
1.2 Kritik an Modernisierungstheorien
2. Dependenztheorien (60ger -70ger Jahre)
2.1 Hauptthesen
2.2 Kritik an Dependenztheorien
3. Verlorene Entwicklungsdekade und alternative Entwicklungansätze (80ger -90ger Jahre)
IV) Post-Development Ansätze
1. Hauptthesen der Post-Development Ansätze
1.1 Ablehnung des konventionellen Entwicklungsparadigmas
1.2 Hilfe als Konstrukt
1.3 Alternativen zur Entwicklung
1.4 Neopopulistische und radikaldemokratische Ausrichtung des Post-Development
2. Poststrukturalismus und Post-Development
3. Der Entwicklungsdiskurs
3.1 Die Diskursanalyse nach Foucault
3.2 Entwicklung als Diskurs
4. Latouche: ein philosophischer Post-Development Ansatz
5. Der Mythos der Armut (nach Rahnema Majid)
6. Hunger und Bedürfnisse
7. Hybridisierung und der „homo comunis“
V) Kritik an Post-Development Ansätzen
VI) Resumee
VII) Post-Development im Feld
1. Entwicklungstheorien und Praxis
2. Post-Development in der Praxis
3. Beispiele für Intiativen aus der Bevölkerung
3.1 Indigene Basisgemeinschaften
3.2 Der Aufstand der „Zapatistas“
4. Beispiele Initiativen im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten
4.1 Community projekt Jagna
4.2 Das EGS Netzwerk
VIII) Fazit