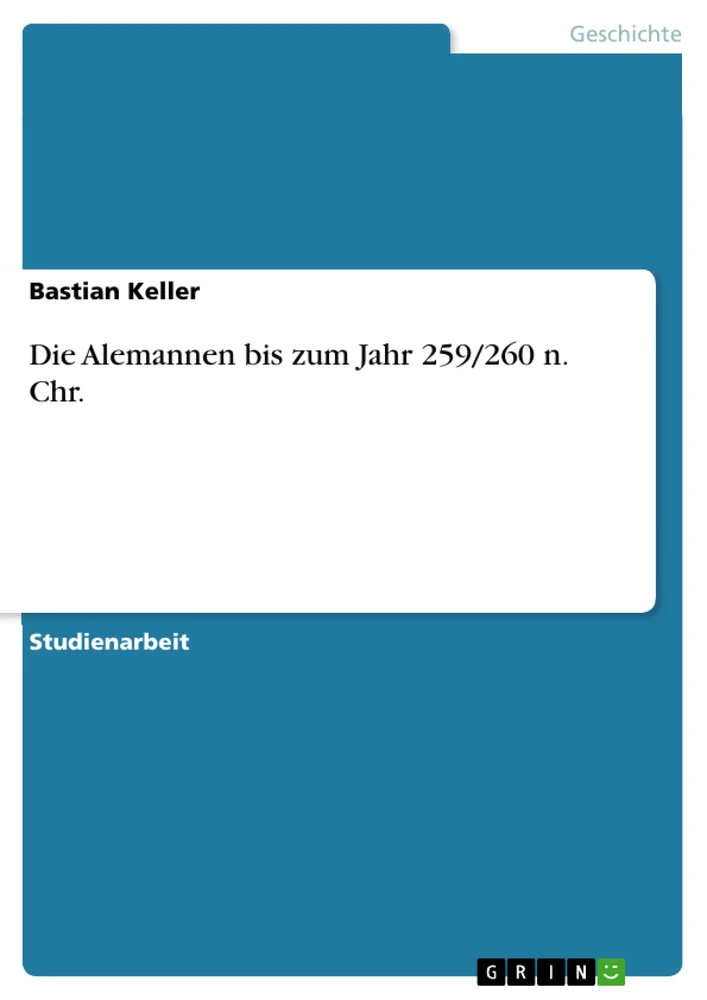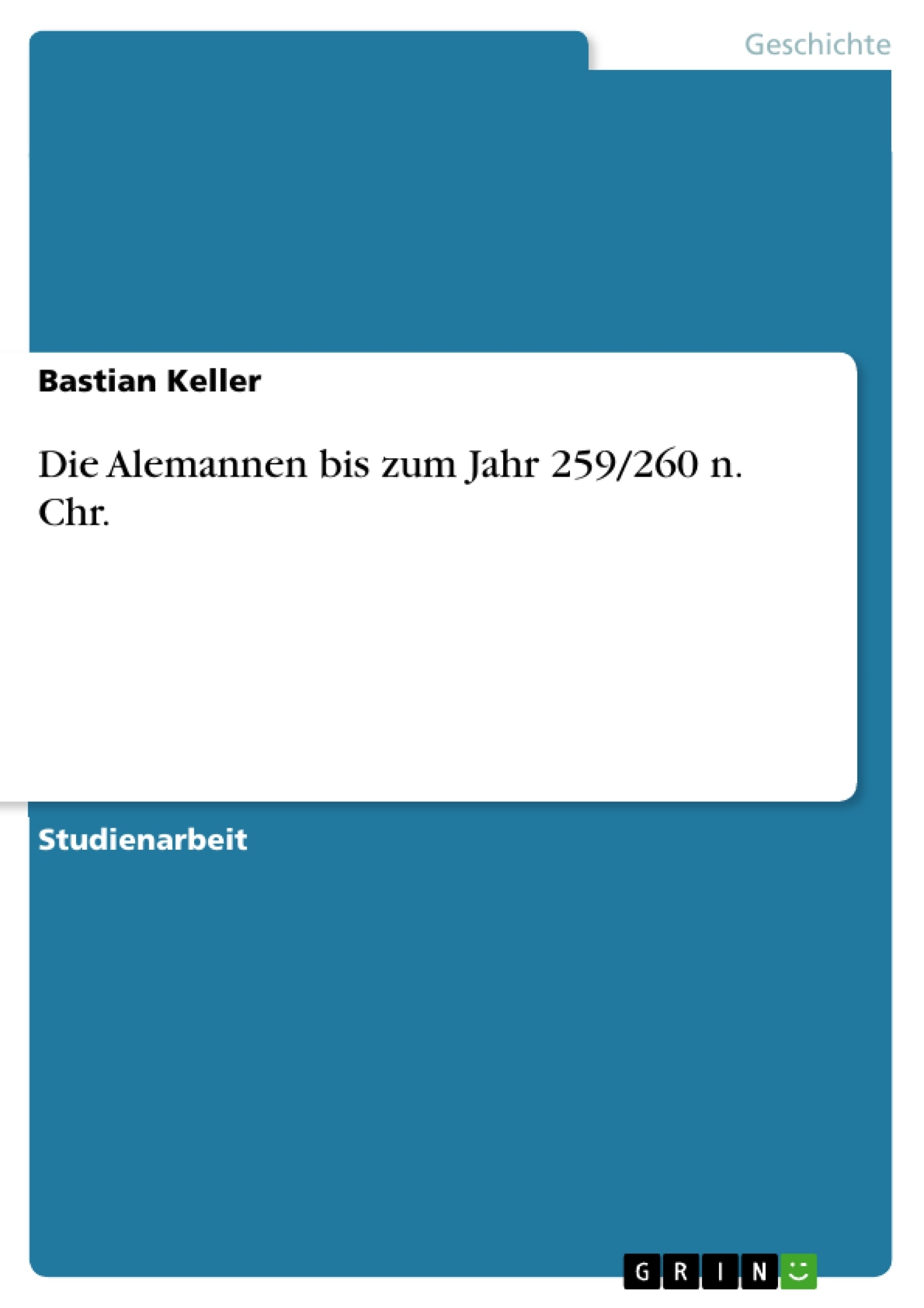Unternimmt man den Versuch, die Geschichte der Alemannen von ihrer ersten umstrittenen Erwähnung bei Cassius Dio, „Antoninus zog gegen die Alemannen, erkaufte aber den Sieg, oder was so aussah, mit Geld.“ , bis zum Jahr 259/260 n. Chr. zu erfassen und zu rekonstruieren, so stellt man innerhalb kurzer Zeit fest, dass man sich hier mit einer Aufgabe betraut hat, die nicht leicht zu bewältigen ist. Ursache, die die Darstellung der alemannischen Geschichte im 3. Jahrhundert n. Chr. erschweren, ist die große Armut an schriftlichen Quellen aus dieser Zeit. Aus diesem Zeitraum kann die Geschichtswissenschaft nur auf sehr wenige schriftliche Überlieferungen zurückgreifen, die allesamt von römischen Historikern verfasst wurden. Die Alemannen selbst überlieferten aus dieser Zeit keine schriftlichen Aufzeichnungen, die einen Einblick in die ihre Geschichte hätten geben können.
Der Geschichtswissenschaft bleibt daher nicht anderes übrig als auf die wenigen Aufzeichnungen der zeitgenössischen römischen Historiker Cassius Dio mit seiner „Römischen Geschichte“ und auf Herodianus mit seinem Werk „Geschichte des Kaisertums nach Marcus“ zurückzugreifen, um etwas über die Geschichte der Alemannen in Erfahrung zu bringen. Diese berichten allerdings nur bis einschließlich der Regierungszeit von Maximinus Thrax. Neben den zeitgenössischen Historikern gibt es darüber hinaus auch viele Erzählungen über die Zeit des 3. Jahrhunderts n. Chr. von nicht zeitgenössischen Geschichtsschreibern, u.a. von Aurelius Victor, von Zosimos, von dem byzantinischen Historiker Johannes Zonaras, aber auch von den Scriptores Historiae Augustae, von denen man Erkenntnisse über die Geschichte der Alemannen gewinnen kann. Allerdings sind diese Nacherzählungen vor allem in Bezug auf den Alemannenname immer kritisch zu betrachten, da ihre Erzählungen über das 3. Jahrhundert n. Chr. erst Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte danach verfasst wurden.
Aufgrund der großen Defizite an schriftlichen Quellen aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. liegt noch ein großer Schatten über den historischen Vorgängen und der Geschichte der Alemannen und deren Herkunft. Dennoch ist es der Forschung gelungen, diesen Schatten teilweise zu beseitigen. Wichtigste Hilfswissenschaft ist dabei die Archäologie.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
I.1 Quellenproblematik
I.2 Definition der Fragestellung
II. Das Imperium Romanum von 235-259/260 n. Chr
II.1 Einordnung in den historischen Kontext: Die römische Reichskrise (235-284 n. Chr.)
II.2 Der Untergang des obergermanisch-raetischen Limes (233-259/260 n. Chr.)
II.2.1 Erster großer Einfall unter Alexander Severus und Maximinus Thrax
II.2.2 Weitere Germaneneinfälle in der Zeit von Gordian III. und Philippus
II.2.3 Weitere Vernachlässigung der Grenzverteidigung
II.2.4 Zusammenfassung der Zeit von Gordian III. bis Aemilianus
II.2.5 Die gemeinsame Regentschaft von Valerianus und seinem Sohn Gallienus
II.2.6 Kaiser Gallienus im Jahr 260 n. Chr
III. Die Alemannen: Herkunft und Ethnogenese
III.1 Aus Sicht der schriftlichen Quellen
III.2 Mit Einbeziehung der Archäologie
IV. Zusammenfassung
V. Literaturverzeichnis