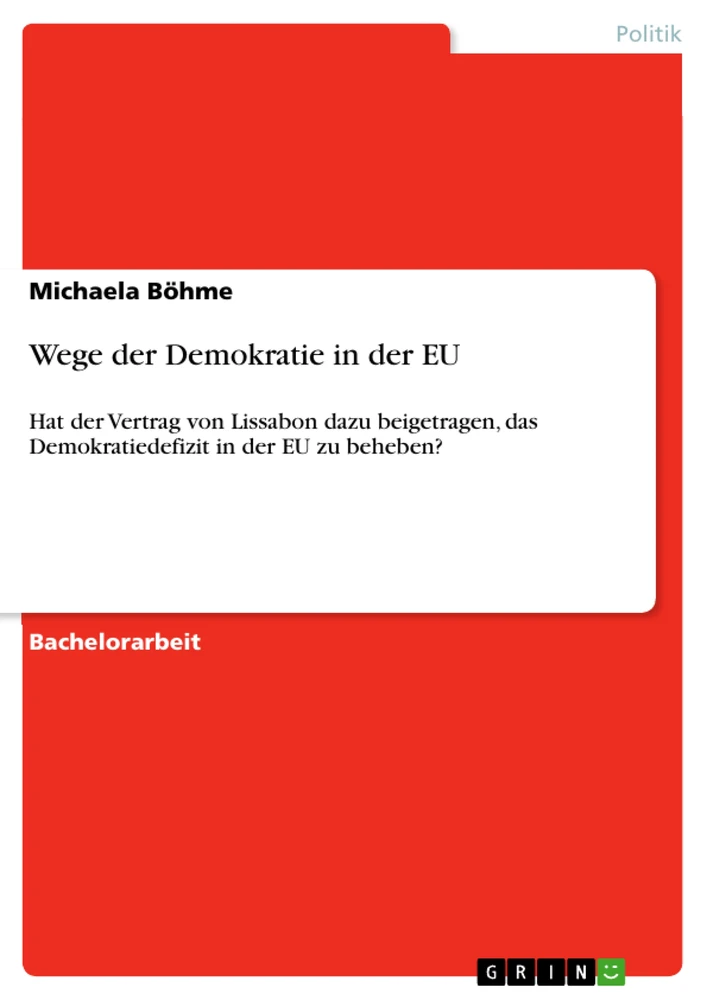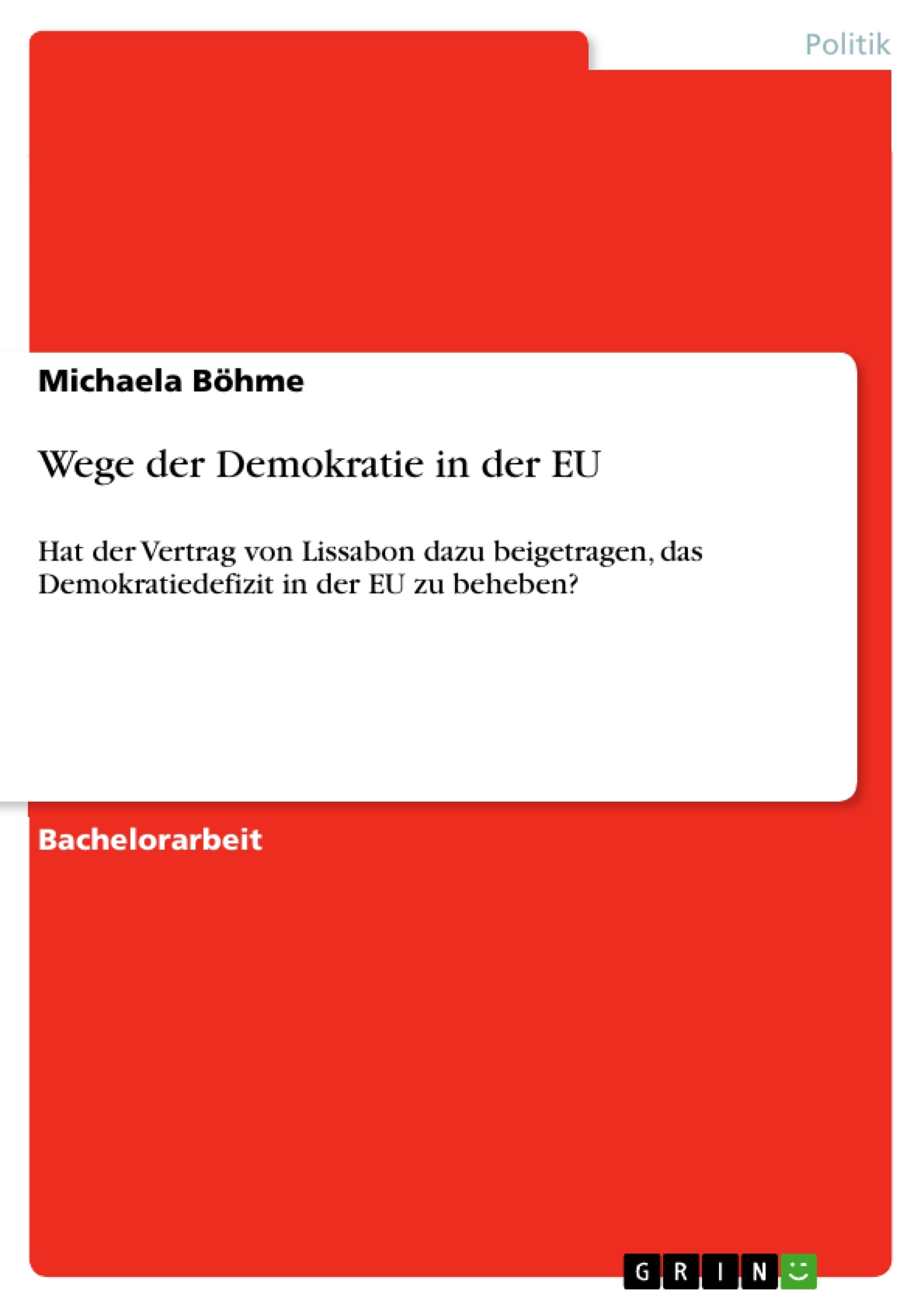Nach der Erläuterung des vertragshistorischen Kontextes von Lissabon klärt diese Arbeit zunächst die Bedingungen für Demokratie in der EU. Dazu werden das Konzept der nationalen Eigenstaatlichkeit sowie der Legitimationsbedarf der EU untersucht. Innerhalb der Ausführung der unterschiedlichen Positionen zur Legitimationsquelle europäischen Handelns werden die Positionen von Majone und Moravcsik, dass ein demokratischer Anspruch der EU utopisch und kontraproduktiv sei, diskutiert. Anschließend soll die These des Demokratiedefizits, Bezug nehmend auf das geltende Recht vor Lissabon, anhand der Begriffe des institutionellen und strukturellen Defizits erläutert werden.
Ein möglicher Demokratisierungsansatz wird mittels der 2005 von Hix und Follesdal veröffentlichten Standardversion des Demokratiedefizits aufgezeigt. Da diese Version die wichtigsten Kritikpunkte in sich eint, soll sie zudem in der Auswertung als Grundlage für eine Bewertung des Demokratiezuwachses durch den Vertrag von Lissabon dienen. Um der Komplexität des Themas gerecht zu werden, wird neben der Standardversion auch auf alternative Demokratisierungsansätze Bezug genommen. Nach einem Zwischenfazit werden exemplarisch die vertraglichen Neuerungen im Lissabonner Vertrag zur Stärkung der Parlamente der Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments sowie die Reformen in Bezug auf partizipative Demokratieelemente analysiert. In der Auswertung wird zum einen geprüft, ob die vertraglichen Reformen die Forderungen aus der Standardversion des Defizits erfüllen und zum anderen, ob die EU auch „demokratischer“ geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II) Einleitend zum Vertrag von Lissabon
III. Merkmale der Demokratie in der EU
a) Die Eigenstaatlichkeit der Europäischen Union
b) Demokratische Legitimation der EU
aa) Output-Legitimation
bb) Input-Legitimation
cc) Legitimation über die nationale Ebene
dd) Legitimation über die supranationale Ebene
IV) Das Demokratiedefizit der EU
a) Die Debatte um das Demokratiedefizit
aa) Das institutionelle Defizit
bb) Das strukturelle Defizit
b) Demokratisierung der EU
aa) Die Standardversion des Demokratiedefizits
bb) Die Demokratisierungsdebatte
V. Zwischenfazit
VI) Demokratisierung der EU durch den Vertrag von Lissabon
a) Vertragliche Neuerungen zur Stärkung der Demokratie
aa) Die Einbindung der nationalen Parlamente
bb) Die Rolle des Europäischen Parlaments
cc) Partizipative Elemente
b) Bewertung der Neuerungen
aa) Bessere Einbindung der nationalen Parlamente?
bb) Stärkung des Europäischen Parlaments?
cc) Impulse für gesellschaftliche Teilhabe?
VII. Auswertung
VIII. Fazit und Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis