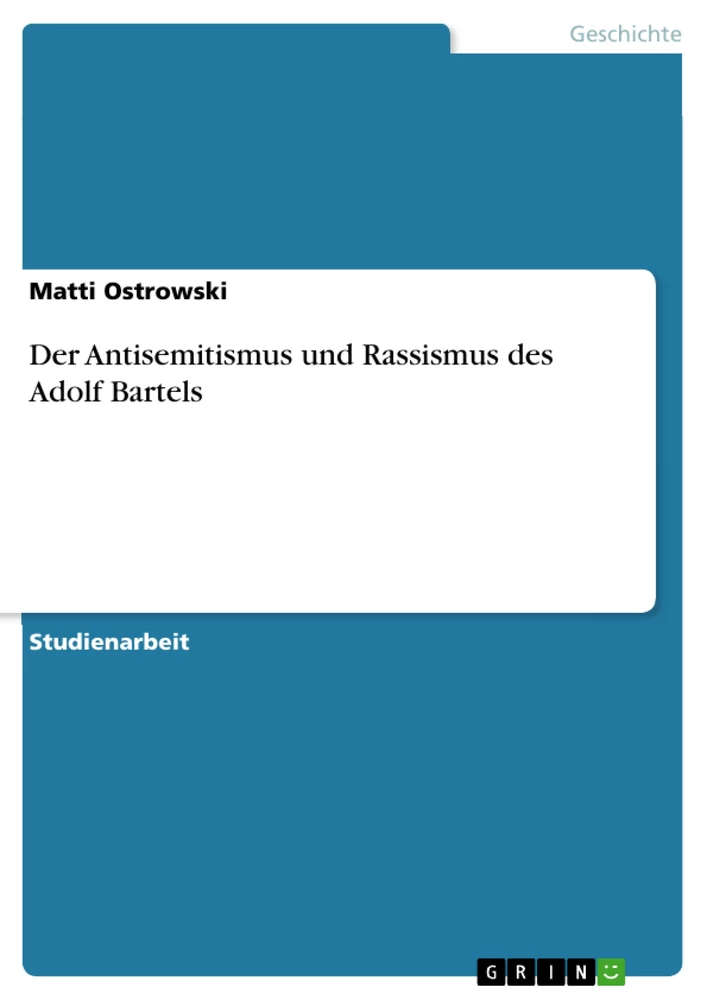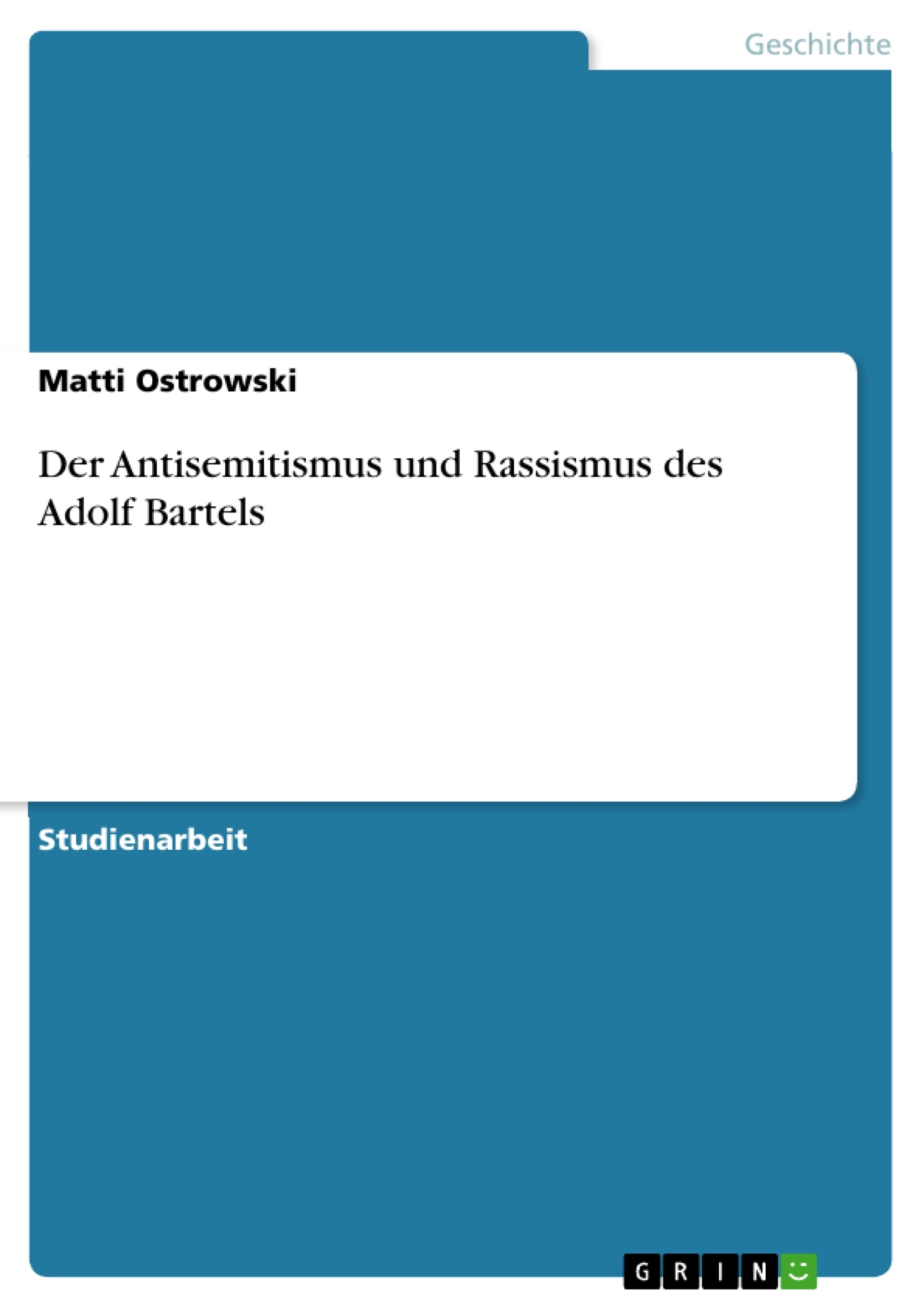Als Mitte des 19. Jahrhunderts auch im Deutschen Reich die Industrialisierung einsetzte vermochte noch niemand zu sagen, welch große Umwälzungen sie mit sich führen sollte. Doch es waren nicht nur große wirtschaftlichen Veränderungen, die das Land grundlegend verändern sollten. Auch und vor allem auf kultureller, wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene wurde das Land innerhalb weniger Jahrzehnte in den Augen vieler Menschen damals auf den Kopf gestellt. Jahrhunderte alte Traditionen, Dogmen, Denkweisen, Gepflogenheiten und Strukturen wurden revidiert oder wurden zumindest von Grund auf angezweifelt.
Eine derart rasante Entwicklung musste Gegenbewegungen hervorrufen. Bewegungen, die versuchten, diese scheinbar zum Untergang der bekannten Welt führende Entwicklung zu erklären und die für diese neue Situation Schuldigen zu suchen. Eine dieser Strömungen war die völkische Bewegung, deren Basis zum Teil der Okkultismus, teilweise auch landwirtschaftlich – romantische Strömungen waren, aber auch der Antijudaismus bzw. später der Antisemitismus. Dieser entwickelte sich im Kaiserreich bis zum ersten Weltkrieg vor allem in intellektuellen Kreisen, konnte aber spätestens während der Weimarer Republik durch deren Agitatoren und Publizisten großflächig verbreitet werden.
Einer dieser Verfechter des Antisemitismus war der Literaturhistoriker Adolf Bartels, der durch seine provokant vorgetragenen rassistischen und antisemitischen Ideen den Nerv der Zeit traf und eine völkische Musterkarriere einschlagen konnte. Er entwickelte sich vom Kritiker jüdischer Schriften zu einem politisch und gesellschaftlich engagierten Gegner alles jüdischen und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die Nationalsozialisten auf ihn und seine Ansichten aufmerksam wurden, wenngleich er deren spätere Radikalität in der Umsetzung der „Judenfrage“ nicht teilte.
Doch wer war Adolf Bartels? Worauf beruhte sein Stolz, Antisemit zu sein? Was bedeutete für ihn Rassismus und Antisemitismus und warum war dies eine seiner zentral vorgetragenen Thesen zur Vermeidung des „Finis Germaniae“? Wie sah er dies und inwieweit konnte er seine Ideen verbreiten und Einfluss auf die Nationalsozialisten üben?
Nach einer kurzen Biographie, werden in dieser Arbeit die aufgeworfenen gestellten Fragen eine zentrale Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biographische Daten
3. Der Antijudaismus und Antisemitismus bei Adolf Bartels
3.1 Der Judenhass des Adolf Bartels
3.2 Forderung nach Aus- und Abgrenzung der Juden aus dem kulturellen, politischen und ökonomischen Leben
4. Rassismus bei Adolf Bartels
4.1 „Rassenstolz“
4.2 Kampf gegen die Juden/“Semiten“
4.3 „Rassenzucht“
4.4 „Erhaltung des Volkstums“
5. Adolf Bartels und die Nationalsozialisten.
6. Rezeption
7. Schlussbetrachtung
Literaturangaben