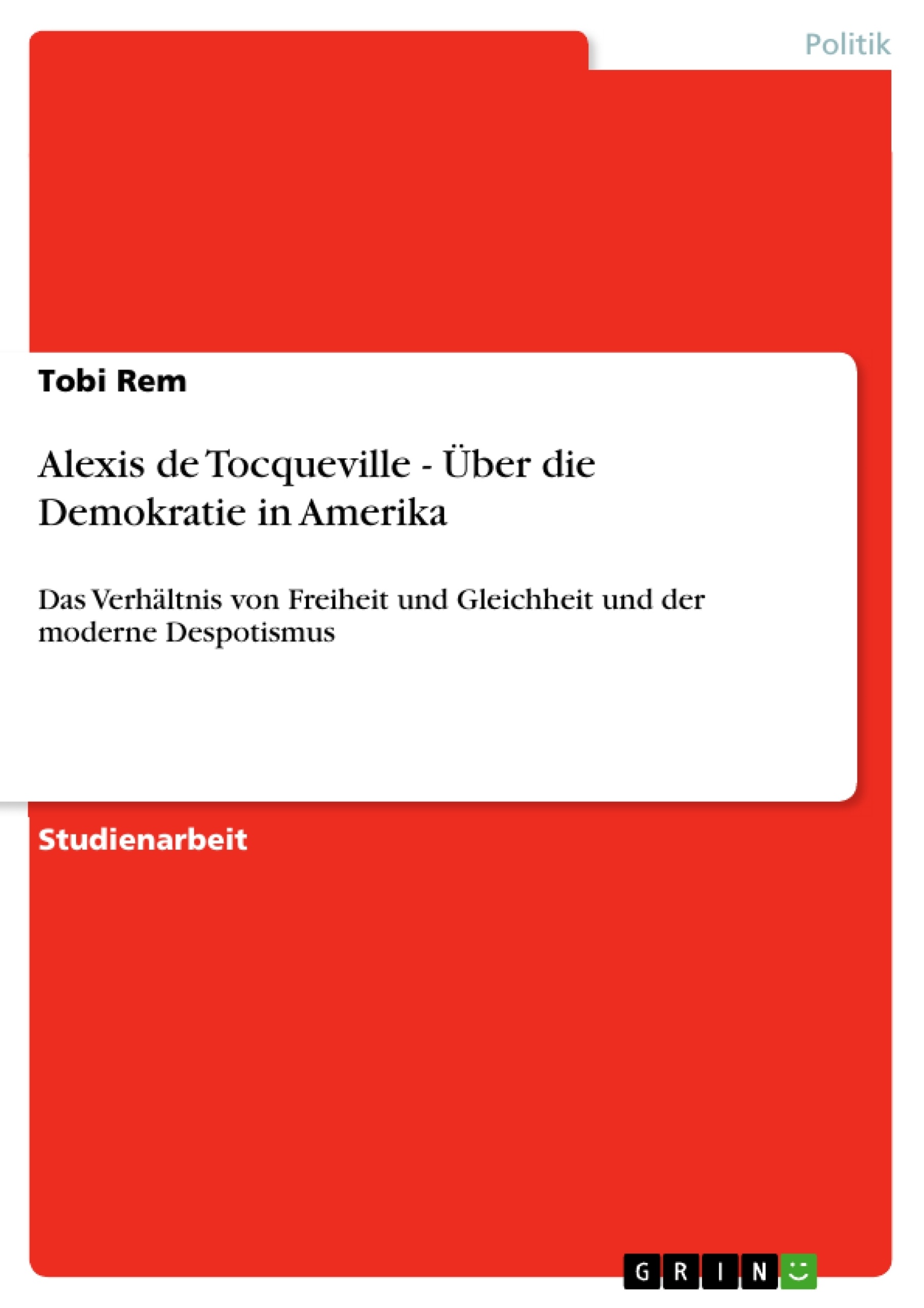Zentrales Thema dieser Arbeit ist die zweiteilige Schrift „Über die Demokratie in Amerika“ („De la démocratie en Amérique“), die als Hauptwerk Alexis de Tocquevilles gilt und deren zentrale Inhaltspunkte und Thesen erläutert werden, schwerpunktmäßig Tocquevilles Einstellung zur Demokratie an sich, die Dialektik von Freiheit und Gleichheit und die Vision des „modernen Despotismus“.
Alexis de Tocqueville - Über die Demokratie in Amerika
Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit und der moderne Despotismus
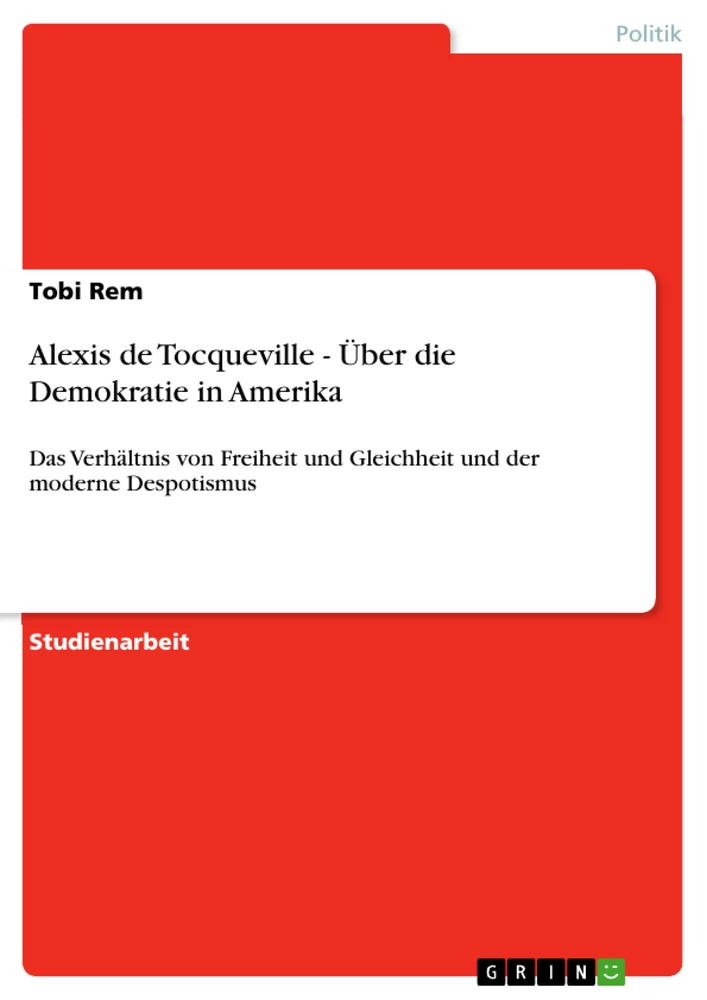
Hausarbeit , 2010 , 10 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Tobi Rem (Autor:in)
Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte
Leseprobe & Details Blick ins Buch