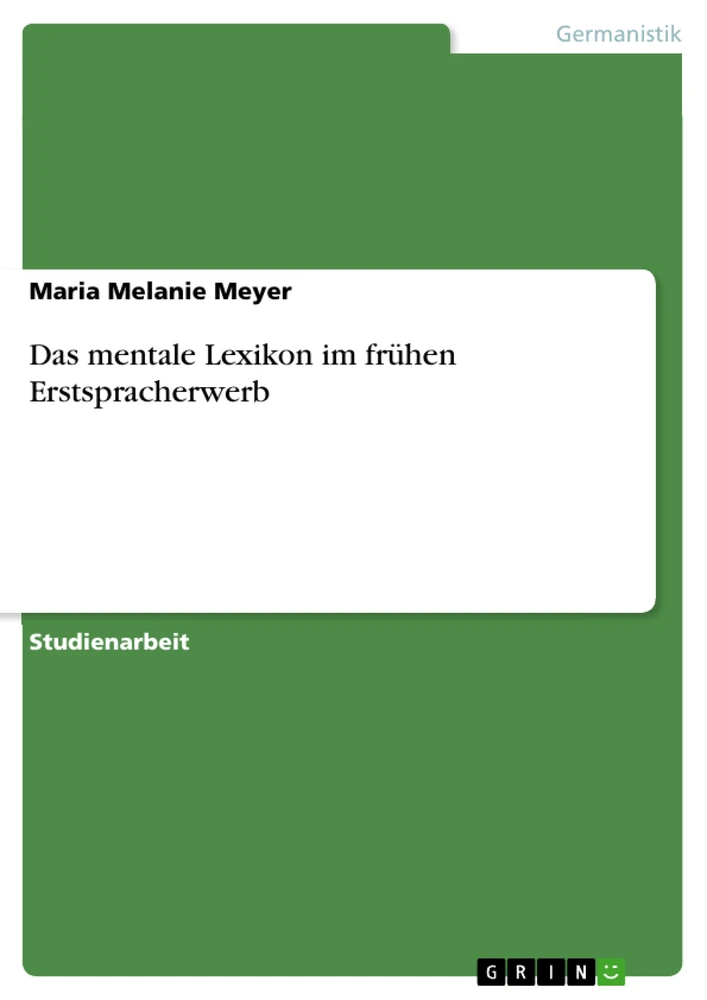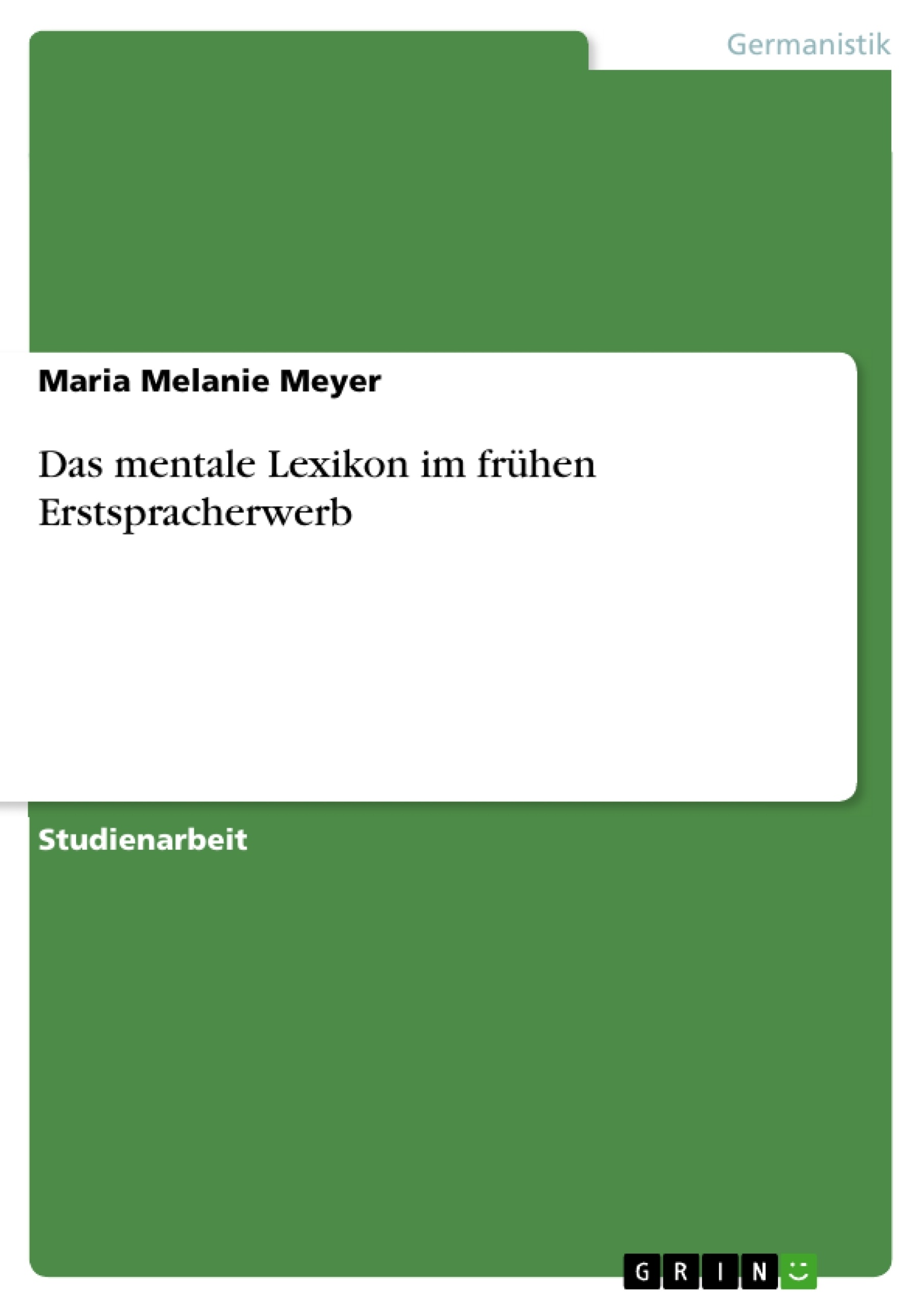Das Geheimnis der Sprache – so lautete unlängst der Titel einer Ausgabe des Magazins Geo Wissen. Im Fokus standen im Allgemeinen die menschliche Sprache, welche bereits im Vorwort der Zeitschrift als „die bedeutendste Errungenschaft der Menschheit“ (Simon 2007: 3) bezeichnet wird, und im Besonderen der Spracherwerb von Kindern. Die menschliche Sprache gilt als das artspezifische Kommunikationsmittel, welches den modernen Menschen von allen anderen Spezies unterscheidet. Seit jeher sind die Menschen fasziniert von dem Phänomen Sprache gewesen. Diese Faszination mag ihren Ursprung unter anderem in der Tatsache haben, dass beinahe alle Kinder ihre Muttersprache (oder Erstsprache) ungeachtet kultureller, sozialer oder intellek-tueller Unterschiede scheinbar mühelos erlernen. Dennoch ist der Erstspracherwerb „die komplexeste aller Aufgaben, mit denen das Kind im Laufe seiner Entwicklung konfrontiert wird“ (Dittmann 2006: 9).
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Das Phänomen Sprache
2 Erklärungsansätze zum Erstspracherwerb
3 Das menschliche Lexikon
3.1 Die Zusammensetzung des Lexikons
3.2 Die Organisation des Lexikons
4 Der Erwerb von Bedeutungen
4.1 Beschreibungsmodelle für die Speicherung von Bedeutungen
4.2 Der kindliche Bedeutungserwerb
5 Der Erwerb von Wörtern
5.1 Der Entwicklungsverlauf des Wortschatzerwerbes
5.2 Semantische Kategorien im kindlichen Wortschatz
5.3 Grammatische Kategorien im kindlichen Wortschatz
6 Der Erwerb von Wortbildungsregeln
7 Fazit: Das Phänomen Lexikonerwerb
8 Literaturverzeichnis