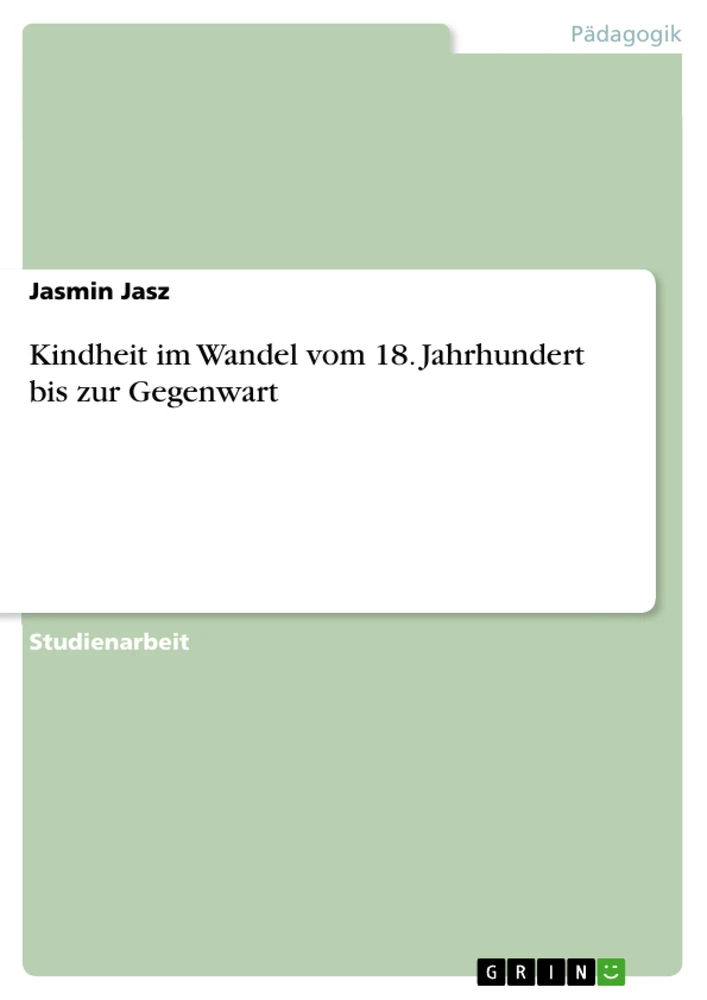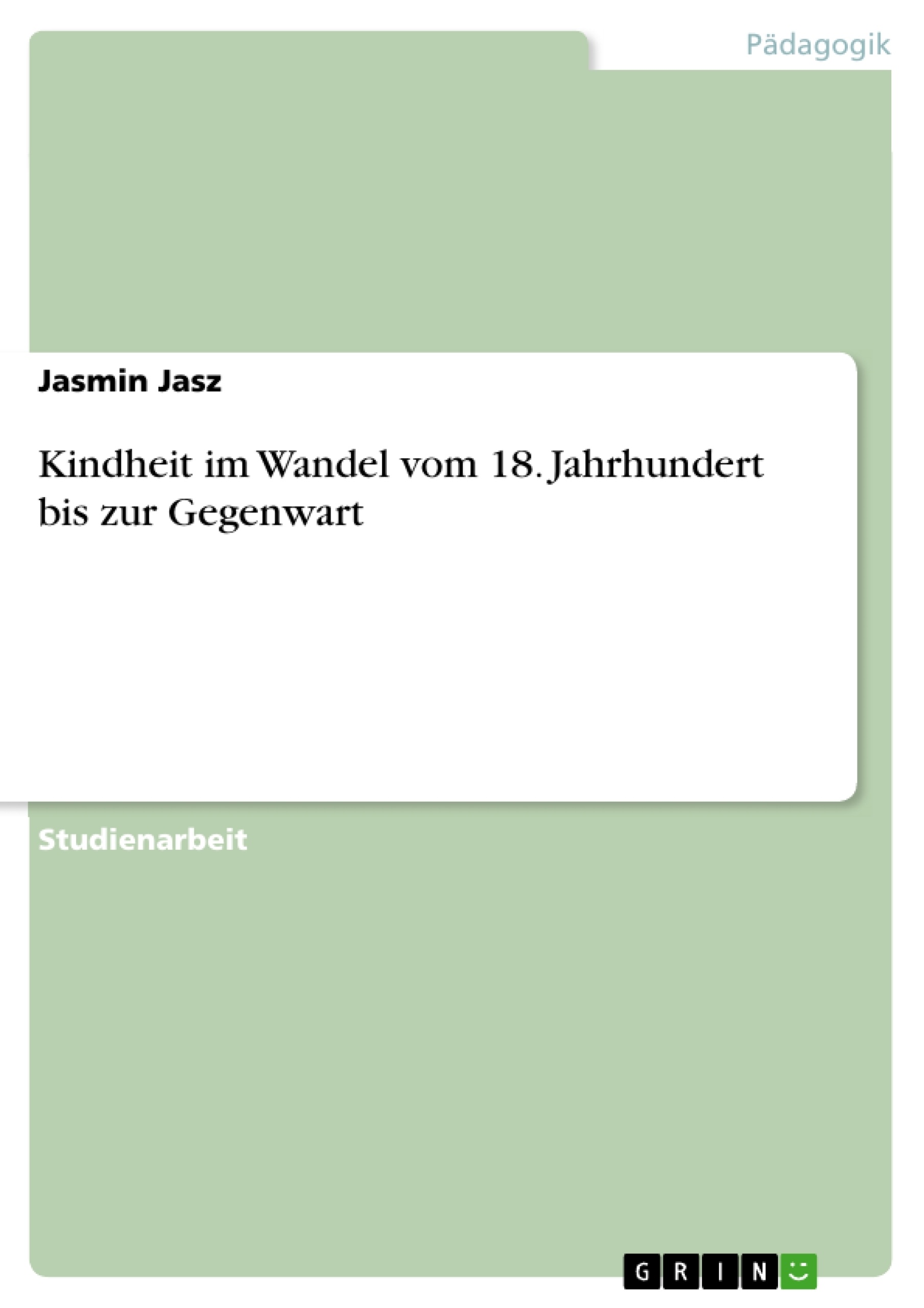„Rund ein Drittel aller Kinder wächst heutzutage ohne Geschwister auf. Trotz der Weiterentwicklung und dem Statusgewinn der Frauenerwerbsarbeit übernehmen nur zwischen 70 und 80 % der Väter Hausarbeit und beteiligen sich weiterhin recht wenig an der Kindererziehung. Mittlerweile werden rund ein Drittel der Ehen geschieden, 13 % (West-) bzw. 18 % (Ostdeutschland) der Kinder wachsen in Teilfamilien sowie 10 % (West-) bzw. 13 % (Ostdeutschland) in Stieffamilien auf. In den neuen Bundesländern ist in 18 % der Haushalte mit Kindern unter 16 Jahren kein Kinderzimmer vorhanden und es erhalten in den alten Bundesländern rund 8% aller Kinder und Jugendlichen Sozialhilfe, leben also in Armut“ (Bendit, Gaiser und Nissen 1992, S. 24ff.).
Aufgrund der Pluralisierung und Individualisierung familialer Lebensformen wachsen Kinder in Mehrkinder-, Einzelkind-, Teil-, Stief-, Dreigenerationen-, Adoptiv- und Pflegefamilien, in nichtehelichen Lebens- und Wohngemeinschaften auf.
Die folgende Arbeit behandelt den Wandel der Kindheit vom 18. Jahrhundert bis hin zur heutigen Zeit. Dabei wird zunächst kurz auf die „Entdeckung der Kindheit“ von Ariès im 2. Kapitel eingegangen. Im 3. Kapitel wird die Entwicklung der modernen Kindheit näher beleuchtet, wo-bei dann die Kindheit in der bürgerlichen Familie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Kindheit in der proletarischen Familie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben wird. Abschließend wird die Kindheit in der heutigen Zeit in besonderen Familienformen anhand der Stieffamilie und Ein-Eltern-Familie dargestellt
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die historische Entwicklung der Lebensphase Kindheit
3. Die Entwicklung moderner Kindheit
a. Kinder in burgerlichen Familien
b. Kinder in proletarischen Familien
c. „Kindsein“heute
4. Entwicklung von Kindern in Stieffamilien
5. Kinder in Ein-Eltern-Familien
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis