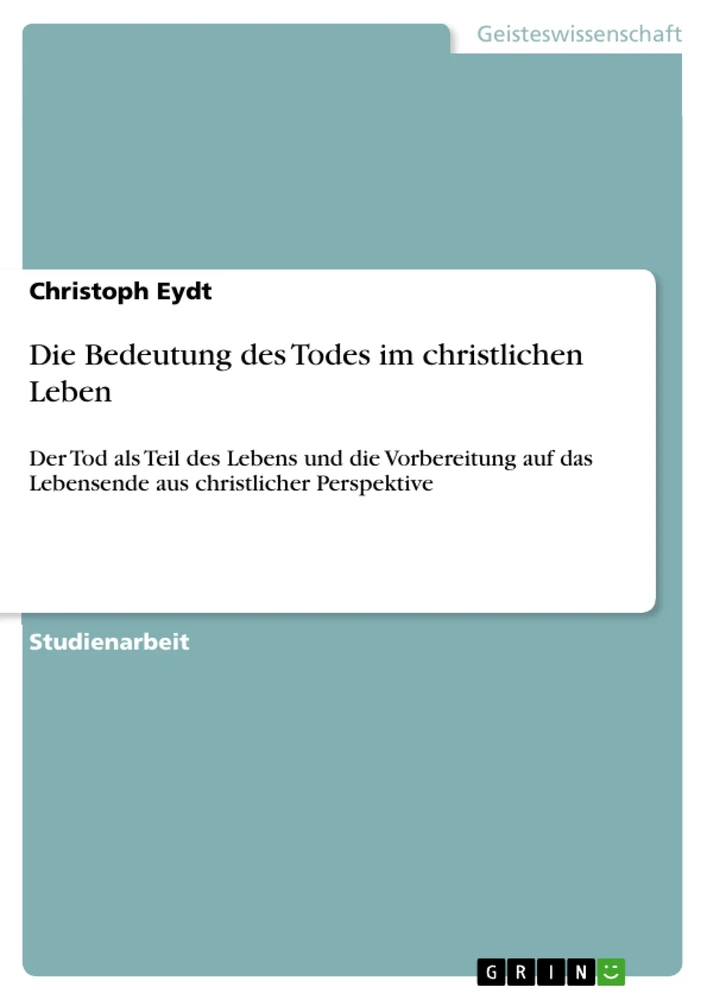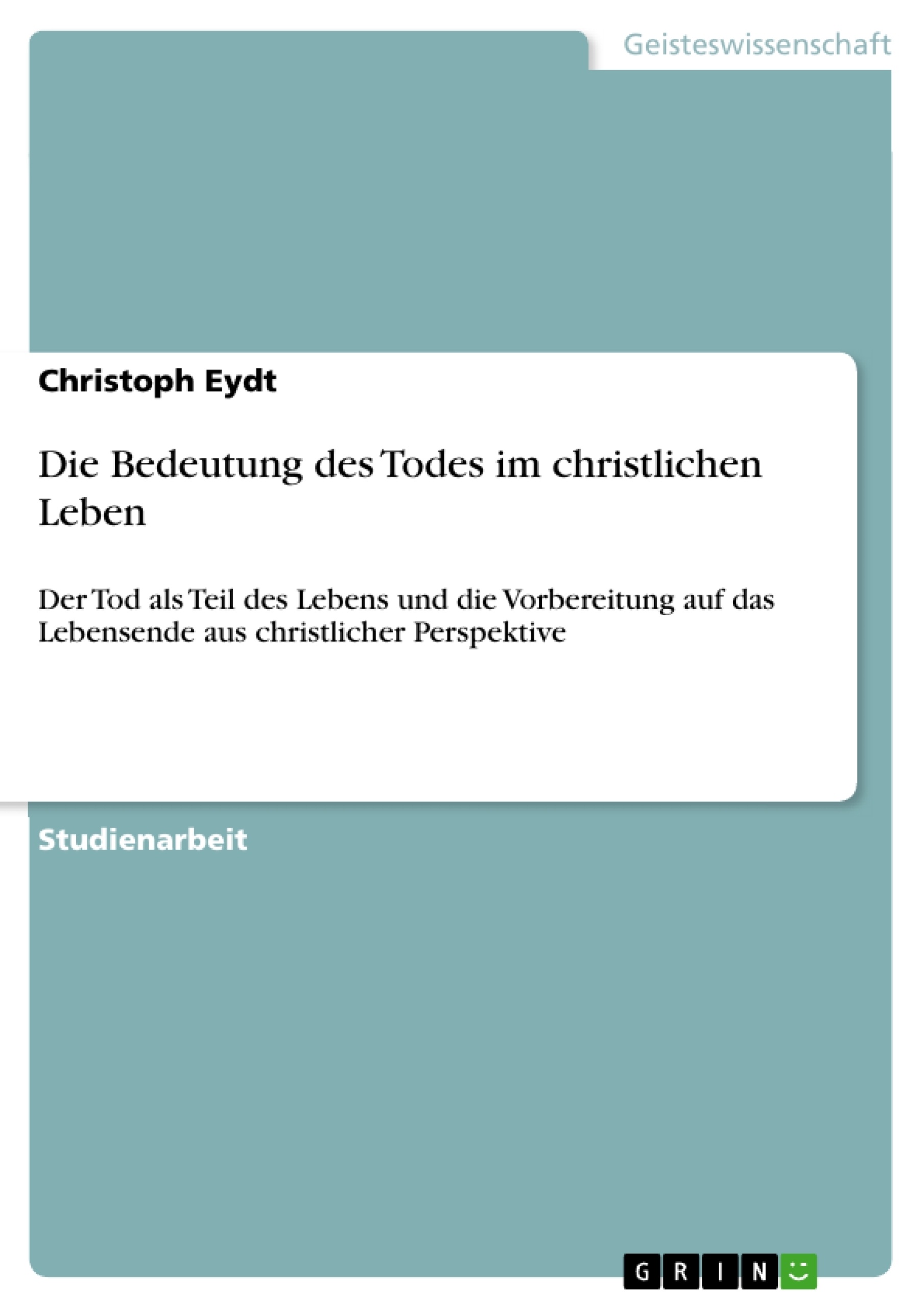Die folgende Arbeit befasst sich mit der Thematik des Lebensendes und der damit zusammenhängenden christlichen Deutung von Leben und Tod. Nach einigen notwendigen Vorbetrachtungen widmet sich der Hauptteil der Arbeit der Frage, wie ein christliches Leben gestaltet werden kann, wenn man es vom Tode her denkt. Wie kann man sich also als Christ auf den Tod vorbereiten?
Das Thema geht auf den erkennbaren Trend der Gesellschaft zurück, den Tod und alle damit in Verbindung gebrachten Theorien, Denkansätze und Aussagen immer weniger zu diskutieren. Zurückzuführen ist dies auf die zunehmende Verdrängung unbequemer Themen aus der Gesellschaft. Seit längerem ist das Phänomen zu beobachten, dass das Thema „Tod“ in sämtlichen Bereichen außen vorgelassen wird, auch in der Pastoralarbeit. So wird der Tod primär nur dann aufgearbeitet, wenn ein Todesfall eingetreten ist. Diese Vorgehensweise ist alarmierend, da es sich bei jener Verarbeitung lediglich um eine Nachbearbeitung handelt. Der Tod sollte aber, so ist zumindest meine Meinung, vorsorglich bedacht und bearbeitet werden, damit die Menschen genug Zeit und Gedanken haben, sich entsprechend auf ihn einzustellen, auch wenn dies nur begrenzt möglich ist, da jede Todeserfahrung individuell gemacht wird. Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich auf der theoretischen Ebene mit dem Lebensende zu befassen, damit man sich mit dem bereits entfremdeten Tod weitestgehend vertraut machen kann.
Die Arbeit orientiert sich an zwei Gesichtspunkten: an der Bibel und an theologischen Aussagen, die letzten Endes auf die Bibel zurückführen. Unter diesen Aspekten soll deutlich werden, wie der Tod verstanden werden kann und wie man sich als Christ auf ihn vorbereiten kann.
Das folgende Kapitel geht auf die Bedeutung des Lebens und des Todes ein.
Im Vordergrund steht dabei die christliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung biblischer Grundlagen.
Das dritte Kapitel der Arbeit befasst sich mit zentralen theologischen Aussagen zum Lebensende. Hier soll die Frage beantwortet werden, wie man den Tod verstehen kann. Dabei sollen auch die Themen „Himmel“, „Hölle“ und „Fegefeuer“ aufgegriffen werden. Gegenwärtig sind diese Begriffe immer noch ein Mysterium und werden oft verwechselt, beziehungsweise missverstanden.
Der vierte Teil der Arbeit geht der Frage nach, wie man mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse ein gelingendes Leben als Christ führen kann, um sich bestmöglich auf den Tod vorzubereiten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Leben und der Tod im biblischen Kontext
2.1 Das Alte Testament
2.1.1 Der Gegensatz von Tod und Leben
2.1.2 Im Kontext des Neuen Testaments
2.1.3 Der dualistische Tod im Alten Testament
2.2 Das Neue Testament
2.2.1 Die Worte Jesu
2.2.2 Der Apostel Paulus und die Rede vom Tod und der Auferstehung
3. Christliche Deutungsmuster
3.1 Der Tod im Kontext christlicher Deutungsansätze
3.1.1 Der Tod als Erfüllung des Lebens
3.1.2 Der Tod als Einschnitt beziehungsweise als Übergang
3.1.3 Der Tod als die wahre Geburt des Menschen
3.1.4 Die Auferstehung als Schluss der Menschwerdung
3.1.5 Die Gestalt des auferweckten Leibes
3.2 Die drei großen eschatologischen Begriffe „Himmel“, „Hölle“ und „Fegefeuer“
3.2.1 Das Gericht
3.2.2 Das Fegefeuer
3.2.3 Der Himmel
3.2.4 Die Hölle
4. Die Faktoren eines gelingenden Lebens
4.1 Ein Bewusstsein für die Existenz und den Tod
4.2 Bewusstes Handeln
4.3 Anforderungen an die Pastoral
5. Zusammenfassung