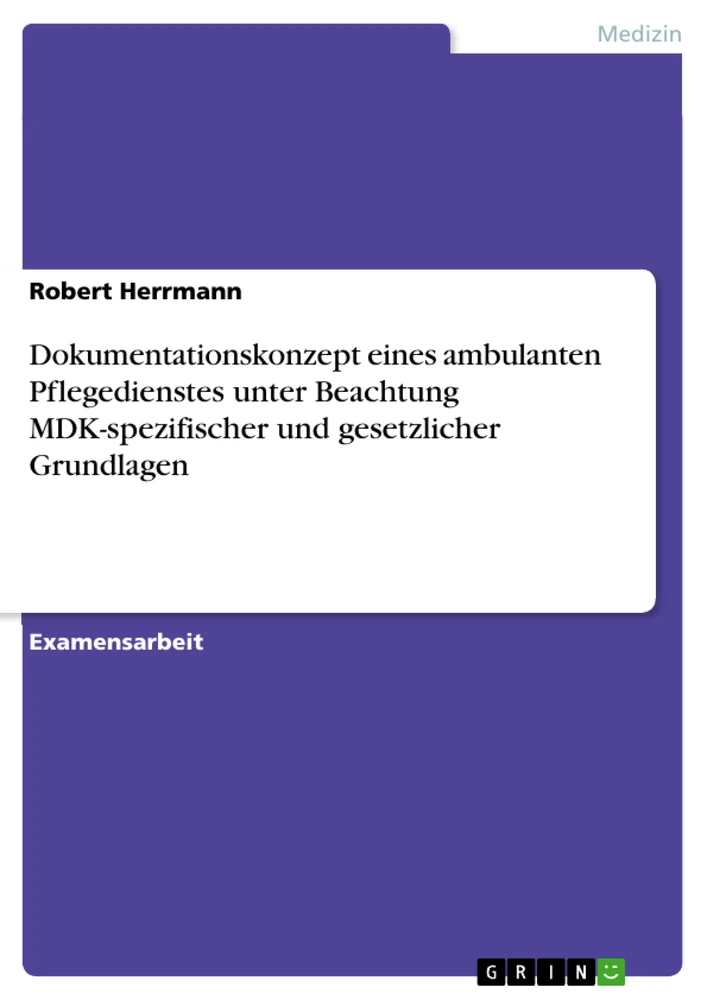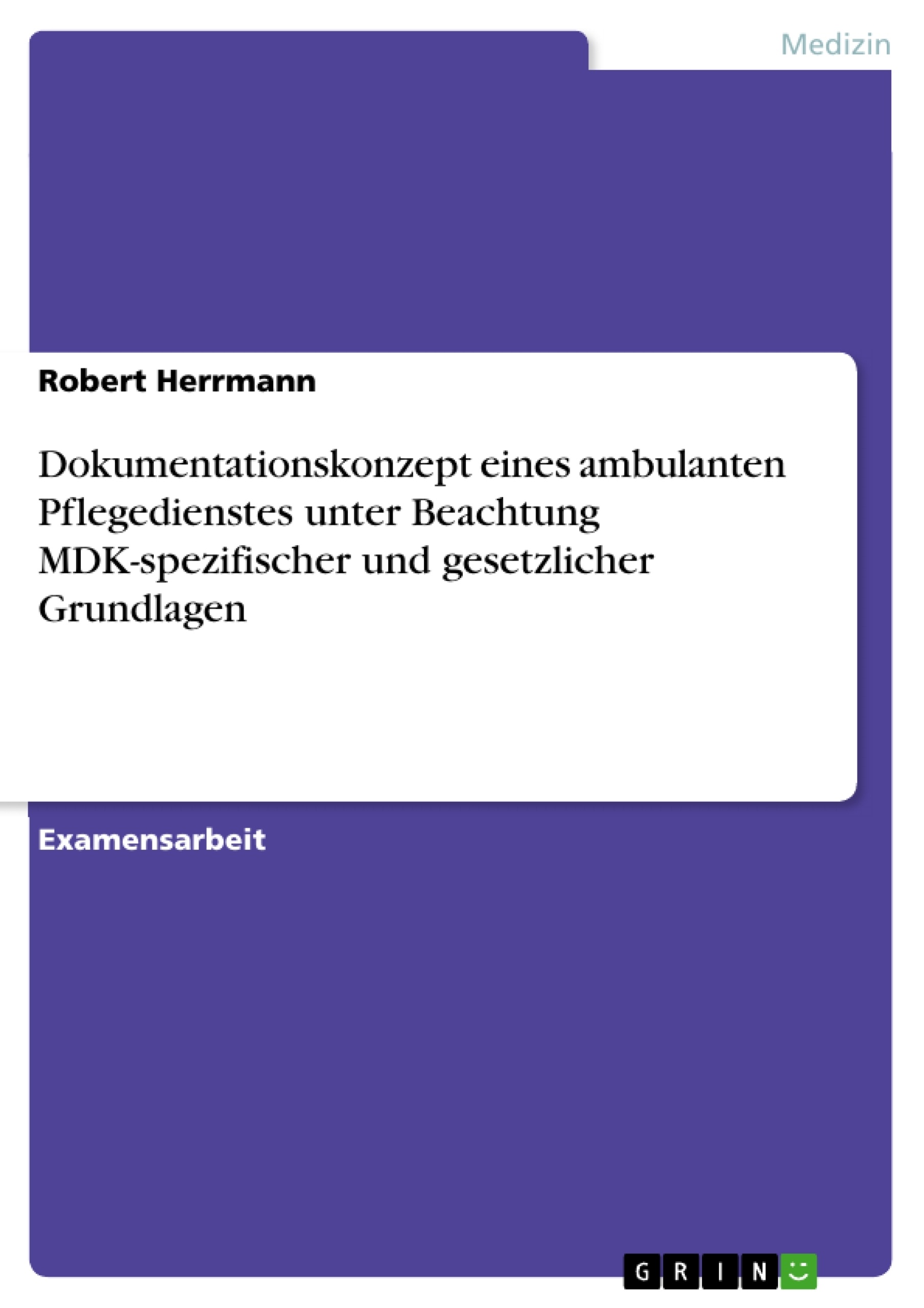Das Thema Dokumentation beschäftigt Mitarbeiter auf allen Ebenen in der Pflege, und deren Ansichten hierzu gehen in unterschiedliche Richtungen. Der hohe bürokratische Aufwand ist auch am Pflegesektor nicht vorbeigegangen, denn immer wieder neue Anforderungen sorgen häufig für Verwirrung der Mitarbeiter. Teilweise wird sie als notwendiges Übel oder als überflüssige Bürokratie angesehen, weil den meisten Mitarbeitern die Bedeutung einer prozesshaft geführten Pflegedokumentation nicht bewusst ist. Der wichtigste Faktor innerhalb der Dokumentation ist die nicht zu pauschalisierende Qualität. Eine Pflegedokumentation ist für jeden Patienten so individuell, wie seine biographisch und individuell geplante Pflege.
Wie kann eine Pflegedokumentation aufgebaut sein, dass sie den gesetzlichen und MDK-spezifischen Anforderungen gerecht wird und dennoch individuell bleibt? Die Dokumentationsmappe eines jeden Patienten dient als Informationsmedium und Beurteilungsgrundlage für die Qualität in der Praxis, nach § 113 SGB XI.
In den folgenden Abschnitten wird das Thema Dokumentation daher näher betrachtet und versucht, ein Konzept zu geben für eine Musterdokumentation eines ambulanten Pflegedienstes.
Inhalt
1. Abstract
2. Einleitung
3. Begriffsbestimmung Dokumentation
3.1. Bedeutung - Ziele
3.2. Anforderung Dokumentation
3.3. Rechtliche Grundlagen
4. Inhalte Dokumentation
4.1. Pflegemodell – Pflegeprozess
4.2. Anamnestische Dokumentation
4.2.1. Grundbausteine
4.2.2. Biographie
4.2.3. Ressourcen – Probleme
4.3. Pflegeplanung
4.4. Durchführungsnachweis
4.4.1. Durchführungskontrolle - Pflegebericht
4.4.2. Leistungsnachweis SBG XI - SGB V
4.4.3. Zusatzprotokolle
4.4.4. Haftungsrechtliche Vorgaben
5. Standards – Expertenstandards
5.1. Arten und Form Expertenstandards
5.2. Umsetzung in Dokumentation
6. Qualitätsmanagement – Qualitätssicherung
7. Musterdokumentation nach DAN GSI
7.1. Aufbau und Struktur
8. Fazit
9. Literaturnachweis