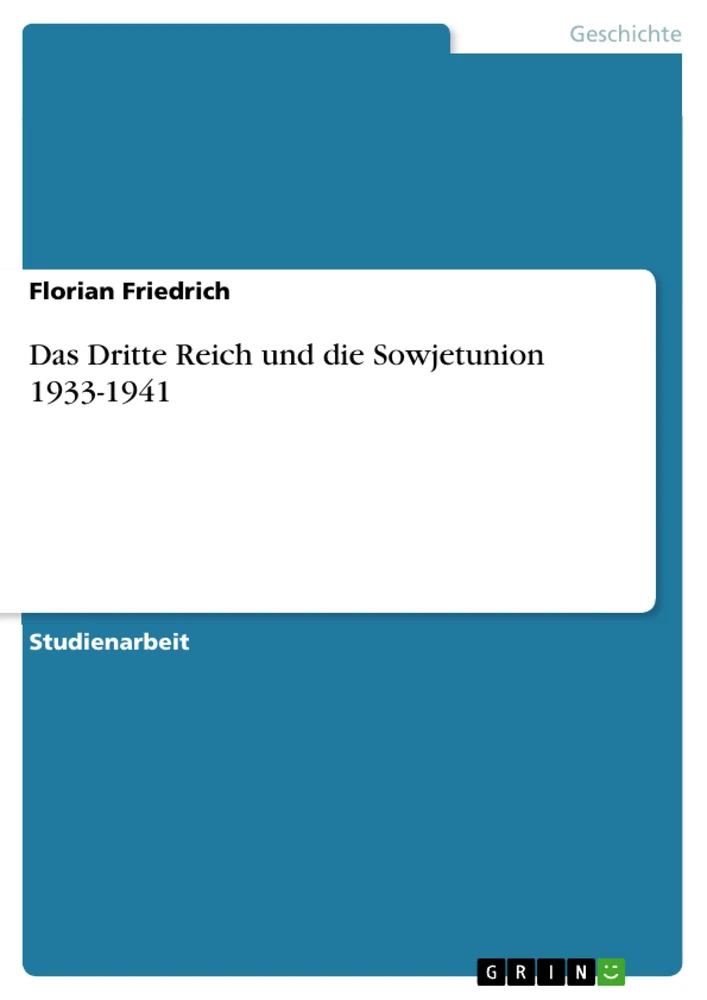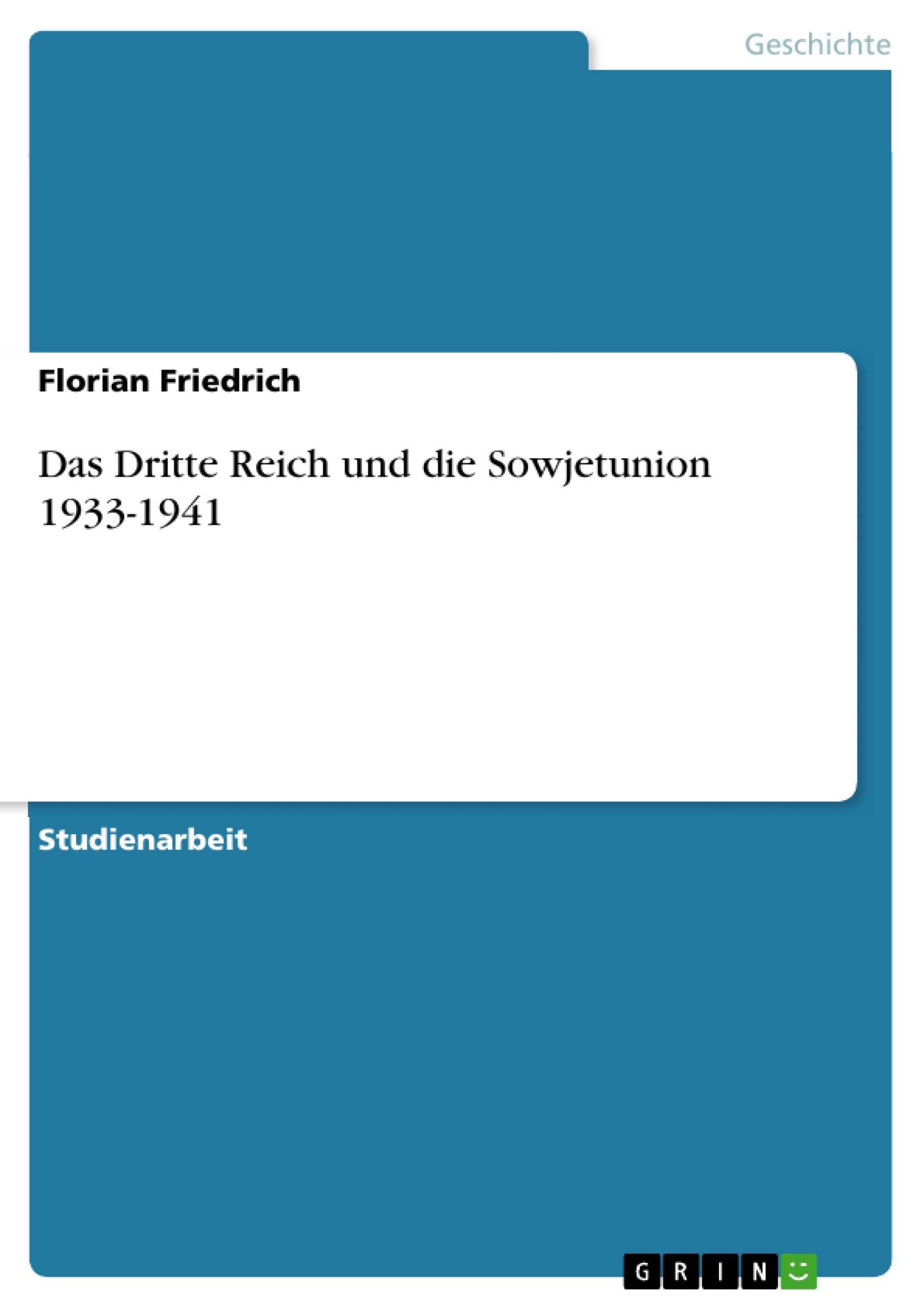Als am 30. Januar 1933 Adolf Hitler die Macht an sich gerissen hatte, glaubten viele Kritiker seinerzeit, es würde sich erneut um eine kurzweilige Regierungsperiode handeln, so wie bei seinen Vorgängern. Solche Stimmen ertönten nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch aus dem Ausland. Dabei hatte Hitler im Vorfeld häufig erklärt, dass die seine Macht, wenn er sie erlangt hatte, nicht freiwillig wieder aus der Hand geben werde. Mit dem sich konsolidierenden nationalsozialistischen Deutschland einerseits und der kommunistischen Sowjetunion andererseits, standen sich auf dem europäischen Kontinent fortan zwei Mächte gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Ideologie des Nationalsozialismus war u.a. durch einen fanatischen Antimarxismus, Antibolschewismus und Antisemitismus geprägt. Bereits in den 20er Jahren des 20. Jh. erklärte Hitler seine außenpolitischen Absichten bezüglich Russlands in seiner Programmschrift „Mein Kampf“. Der Osten sollte durch einen Krieg erobert und anschließend rücksichtslos germanisiert werden, um Lebensraum für deutsche Siedler zu schaffen. Diese Pläne waren der sowjetischen Führung im Januar 1933 wohl bekannt, schließlich hatte Stalin Hitlers „Werk“ ausführlich gelesen. Um so erstaunlicher scheint die Reaktion jener Jahre zu sein. Anstatt einer eindeutigen Distanzierung beider Regierungen, kam es zu einer Annäherung der eigentlichen Todfeinde. Ende August 1939 beherrschte nur eine Schlagzeile die Weltpresse: der Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes.
Im Mittelpunkt dieser Seminararbeit stehen die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion im Zeitraum der Machtergreifung 1933 bis zum Unternehmen „Barbarossa“ am 22. Juni 1941. Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Wie kam es trotz der erheblichen ideologischen Gegensätze zu einer Zusammenarbeit und sogar zum Abschluss des Nichtangriffspaktes kurz vor Kriegsbeginn? Wer ergriff die Initiative? Wie verliefen die Verhandlungen, und vor allem, welche Folgen hatte der Pakt bzw. wie wurde er in den Folgemonaten umgesetzt?
Inhalt
1. Einleitung
2. Die deutsch-sowjetischen Beziehungen in den Zwischen-kriegsjahren
2.1. Anfängliche deutsch-russische Beziehungen
2.2. Vertrag von Rapallo (16. April 1922)
2.3. Berliner Vertrag (24. April 1926)
3. Das Dritte Reich und die Sowjetunion 1933-1939
3.1. Die Rolle Russlands in Hitlers Ideologie
3.2. Die Situation nach der Machtergreifung
3.3. Deutsch-polnisches Abkommen (26. Januar 1934)
3.4. Zuspitzung der Krise
4. Hitler-Stalin-Pakt
4.1. Die Verhandlungen
4.2. Inhalt des Abkommens
4.3. Folgen des Paktes
5. Schlussbetrachtung
6. Bibliographie
6.1. Monographien
6.2. Aufsätze
6.3. Internetquellen