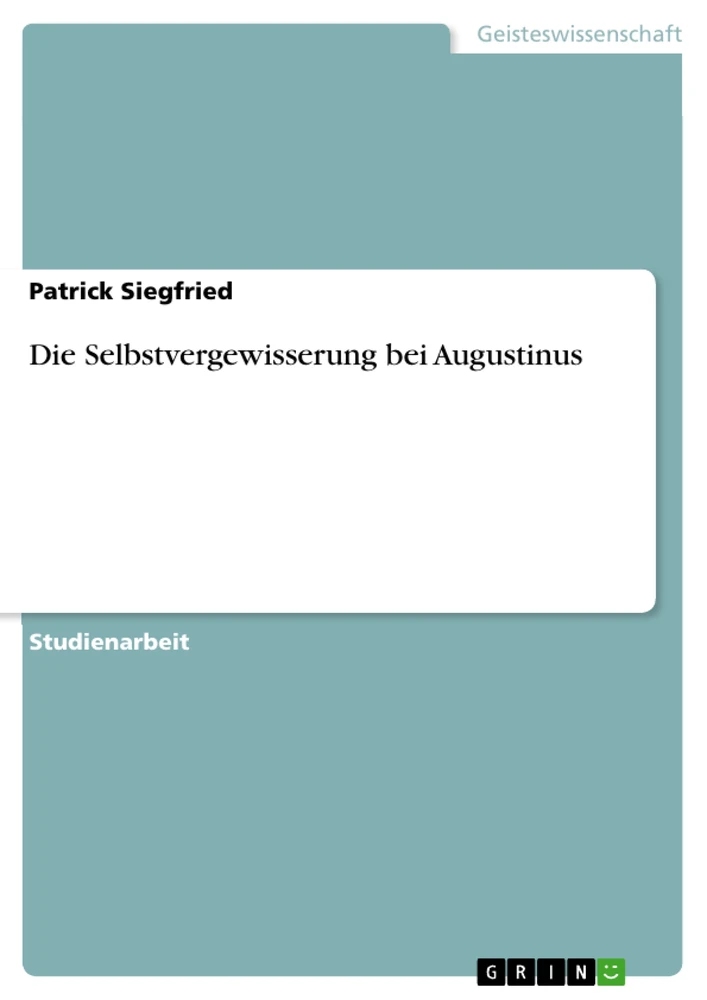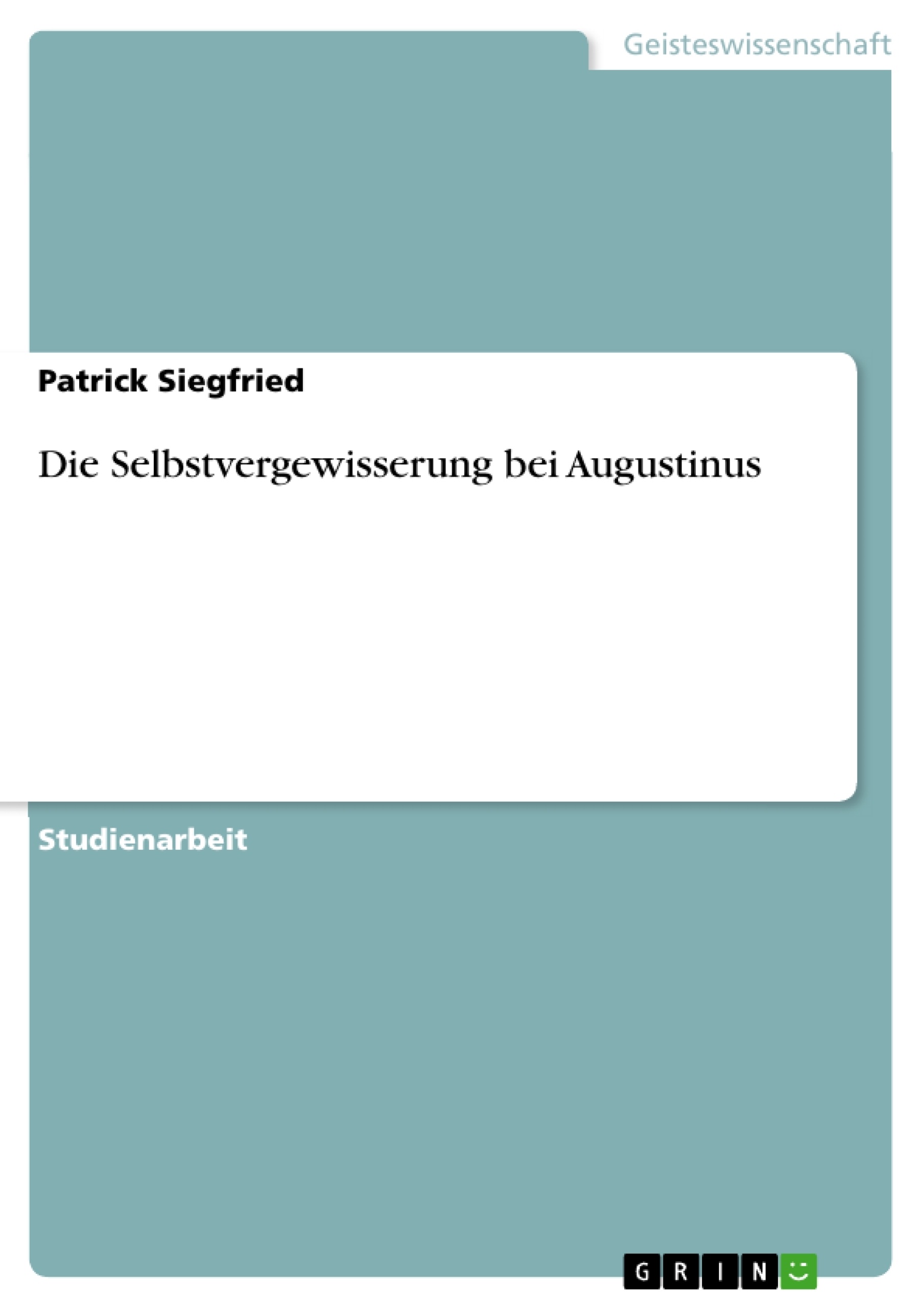Augustinus interessiert sich in seiner ersten Phase seines Denkens, bis ca. 396 für zwei Dinge: Gott und die Seele. Diesen Zielen ordnet er sein Streben nach Erkenntnis unter. Beeinflusst durch die in der Spätantike üblichen Skepsis, ist Augustinus unzufrieden mit den Erklärungen seiner Zeit über die Herkunft des Bösen, Sinn und Zweck des Lebens, kann sich aber andererseits mit dem Zweifel nicht geben. Am Ausgangspunkt seiner Suche steht die „Selbstvergewisserung“:
„Der du den Willen hast, in dich hineinzuschauen, hast du das Wissen auch von deinem Sein? - Ich hab es. -Woher weißt du dies? - Das weiß ich nicht. – Empfindest du dich selbst als einfach oder als ein Vielfaches? - Das weiß ich nicht. - Weißt du, dass du selbst denkst? - Ich weiß es.“
Inhalt:
1. Einleitung
2. Biographische Anmerkungen
3. Der Stellenwert in der Theorie
4. Die Methode
5. Wahrheit als Erleuchtung
6. Fazit
Literaturverzeichnis