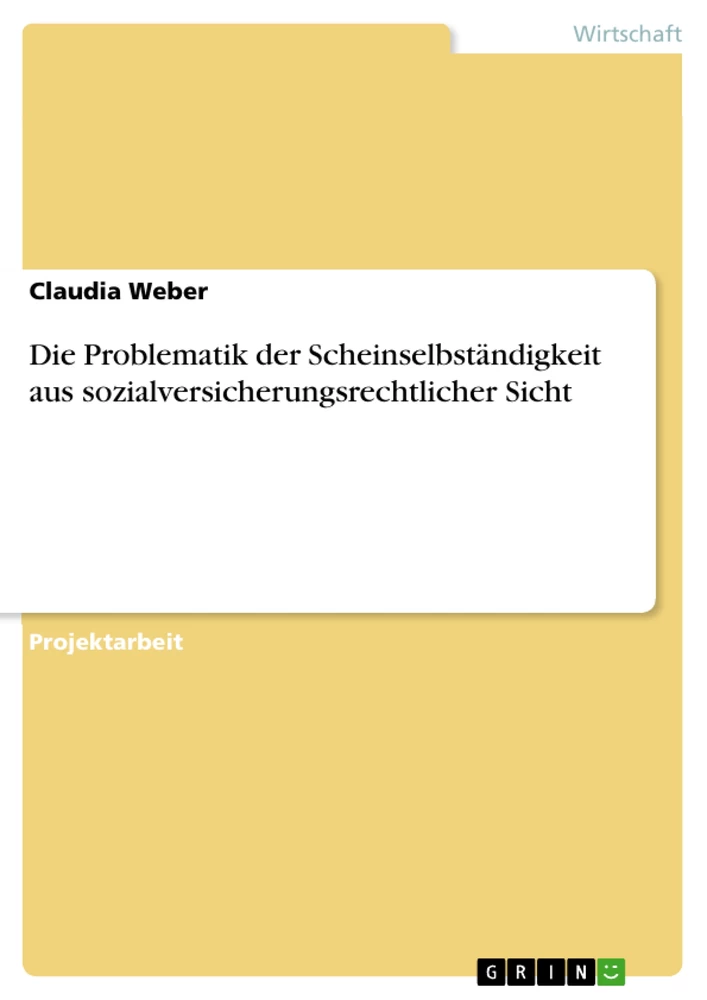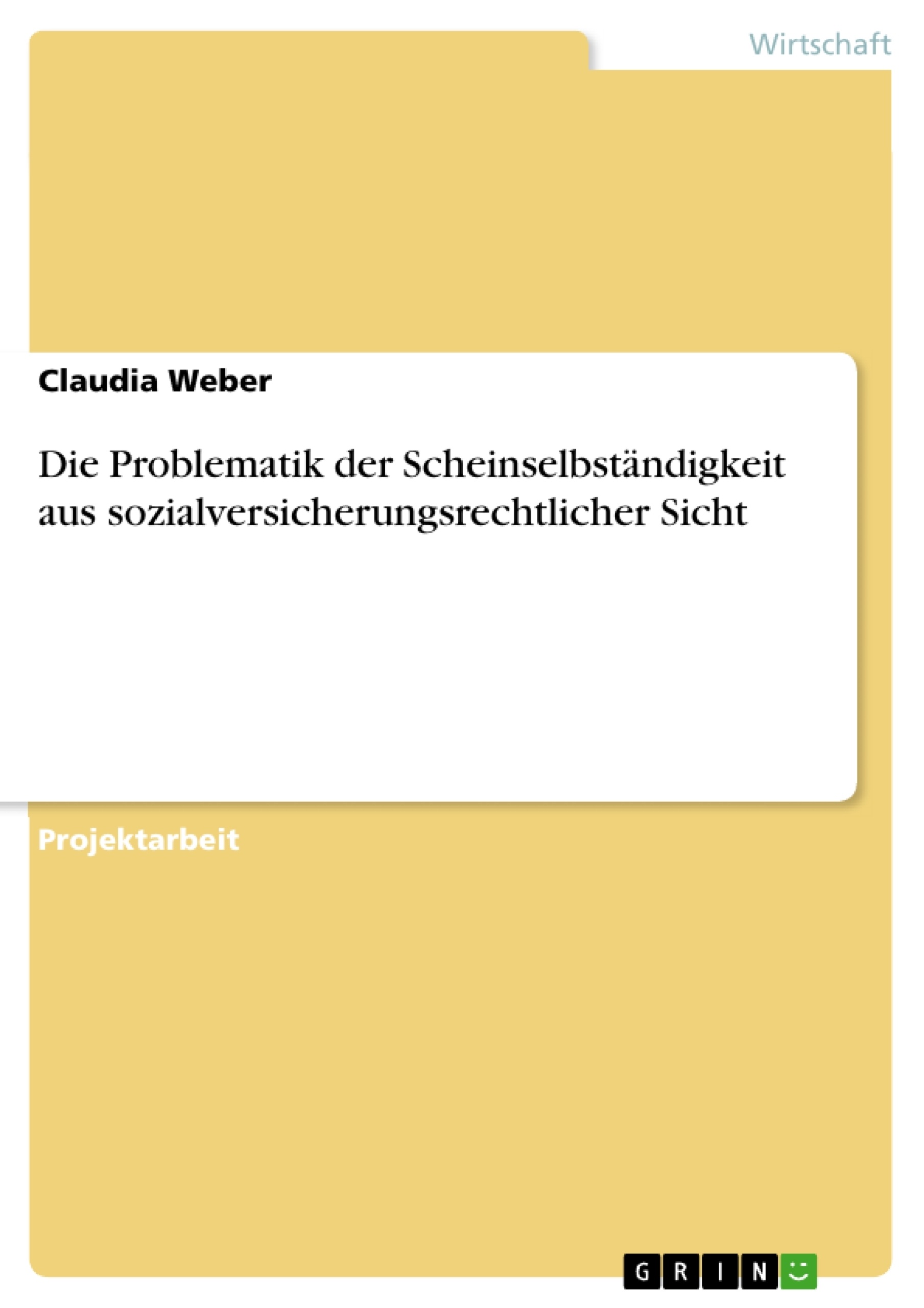Die politisch gewollte „Welle neuer Selbständigkeit“ hat dazu beigetragen, dass die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen immer mehr an Brisanz gewonnen hat (vgl. Maurer 2007, 16). In der Diskussion um die „Scheinselbständigkeit“ wird Arbeitgebern immer wieder vorgeworfen, dass Scheinselbständigkeit von ihnen favorisiert werde, um zwingende Vorschriften aus unterschiedlichen Rechtszweigen wie z.B. Arbeits- oder auch Sozialversicherungsrecht zu umgehen (vgl. Reiserer et al. 2002:3). Auch wenn uns das Phänomen der Scheinselbständigkeit schon seit einiger Zeit begleitet, sind nach wie vor viele Fragen innerhalb der Grauzone dieser Problematik offen und erschweren eine eindeutige Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit (vgl. Försterling 2000: 3).
Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl Interessierten als auch Betroffenen ein nötiges Grundwissen im Zusammenhang mit der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von Scheinselbständigkeit zu vermitteln. Sie soll außerdem dazu beitragen, dass Beteiligten mögliche Konsequenzen bewusst werden, um das Problembewusstsein in diesem Zusammenhang zu verstärken. Vor allem aber soll diese Arbeit als Leitfaden dazu dienen, eine Feststellung von Scheinselbständigkeit und damit die sich ergebenden Konsequenzen weitgehend zu vermeiden. Dazu wird zunächst der Begriff der Scheinselbständigkeit näher definiert und Abgrenzungsmerkmale einer selbständigen Tätigkeit von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis aufgezeigt. Anschließend wird auf die Ursachen für Scheinselbständigkeit eingegangen und die quantitative Entwicklung dieser in den letzten Jahren präsentiert. Die sozialversicherungs-rechtliche Behandlung der unterschiedlichen Personengruppen sowie eine Erläuterung des Statusfeststellungsverfahrens schließen sich der Klärung der grundlegenden Begebenheiten an. Im Folgenden werden die wichtigsten gesetzlichen Entwicklungen der letzten Jahre, welche die Basis für sämtliche Ausführungen auf diesem Gebiet darstellen, erläutert und es werden mögliche Folgen der beteiligten Parteien nach Feststellung einer Scheinselbständigkeit behandelt. Abschließend erfolgt ein kurzer Ausblick auf die künftige Situation sowie Hinweise zur Erkennung und Vermeidung von Scheinselbständigkeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1.2 Problemstellung
2 Scheinselbständigkeit
2.1 Begriff der Scheinselbständigkeit
2.2 Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis
2.3 Ursachen für Scheinselbständigkeit
2.4 Quantitative Entwicklung der Scheinselbständigkeit in den letzten Jahren
3 Sozialversicherung
3.1 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung von abhängigen Beschäftigungsverhältnissen (Arbeitnehmer)
3.2 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung von selbständig Tätigen (Selbständige)
3.3 Statusfeststellungsverfahren der Deutschen Rentenversicherung
4 Gesetzesentwicklung
4.1 Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte
4.2 Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit
4.3 Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
4.4 Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
5 Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen bei einer Feststellung von Scheinselbständigkeit
5.1 Konsequenzen für den Scheinselbständigen
5.2 Konsequenzen für den Arbeitgeber
6 Ausblick
Literaturverzeichnis
Internetquellen