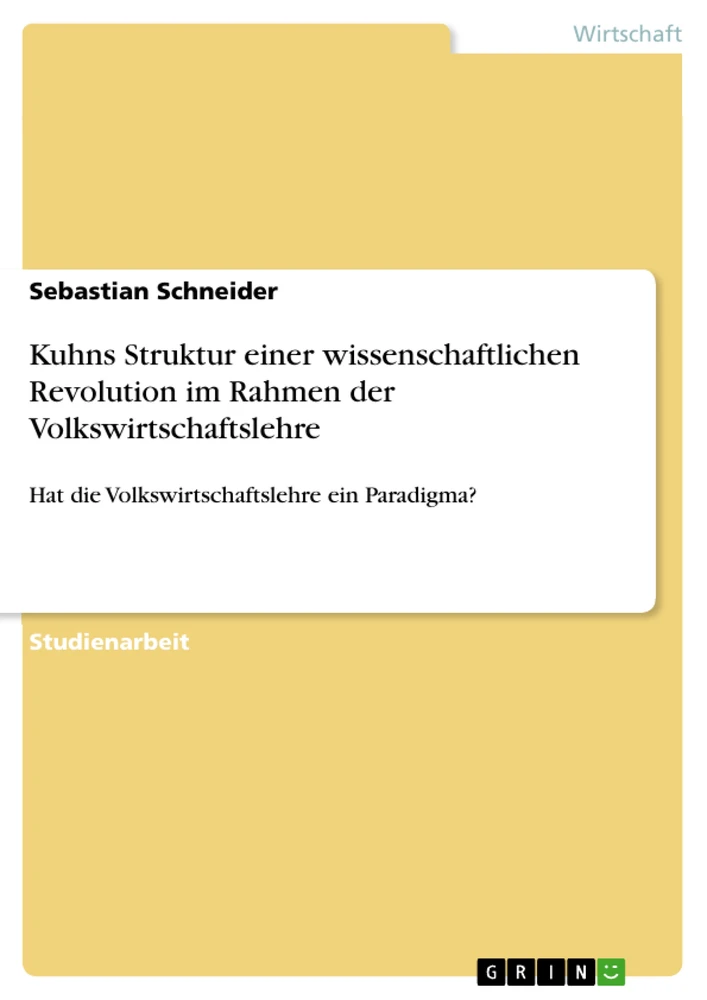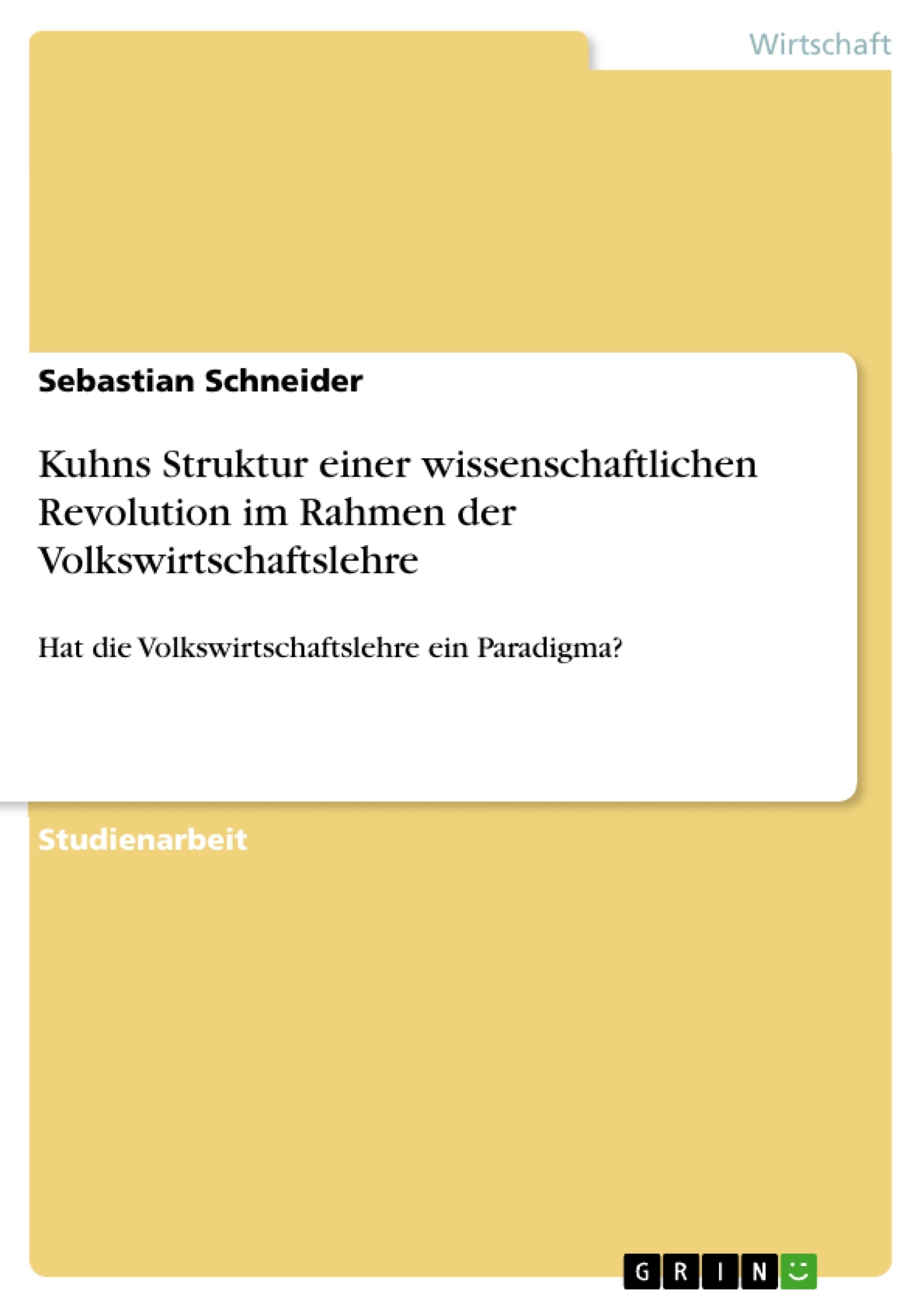Diese Ausarbeitung soll einerseits die Gedanken um die Kuhnsche Paradigmentheorie aufzeigen und andererseits prüfen, inwiefern dieses Konzept, dem ein zyklischer Moment, gekennzeichnet durch das Wechselspiel zwischen Normalwissenschaft und außerordentlicher Wissenschaft, inne wohnt, anwendbar ist auf eine der Sozialwissenschaften, die Volkswirtschaftslehre. Kuhns Konzept fand originär Anwendung auf die Naturwissenschaften, mit Fokussierung auf die Geschichte der Physik. Zu den Sozialwissenschaften sagt Kuhn in seiner SSR, dass sich jene noch in einer vorparadigmatischen Zeit befinden. Inwiefern dies auf die Volkswirtschaftslehre zutrifft, die eine Sozialwissenschaft ist, soll durch die Suche nach etwas, das als volkswirtschaftliches Paradigma verstanden werden kann, geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Kuhnsche Paradigma.
3. Zur vorparadigmatischen Zeit einer Wissenschaft
a. Kuhns Auffassung einer vorparadigmatischen Zeit
b. Zur vorparadigmatischen Zeit der Volkswirtschaftslehre
4. Die Phase der Normalwissenschaft
a. Kuhns Auffassung der normalwissenschaftlichen Phase
b. Die normalwissenschaftliche Phase und die Volkswirtschaftslehre
5. Die wissenschaftliche Revolution
a. Kuhns Auffassung von wissenschaftlicher Revolution
b. Wissenschaftliche Revolution in der Volkswirtschaftslehre?
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis