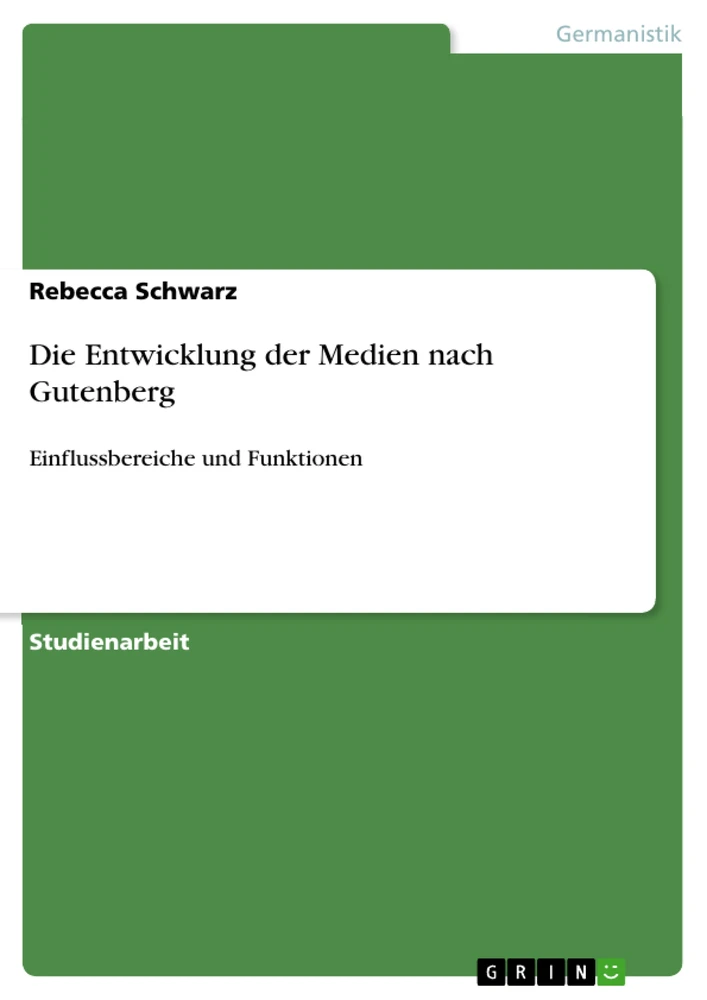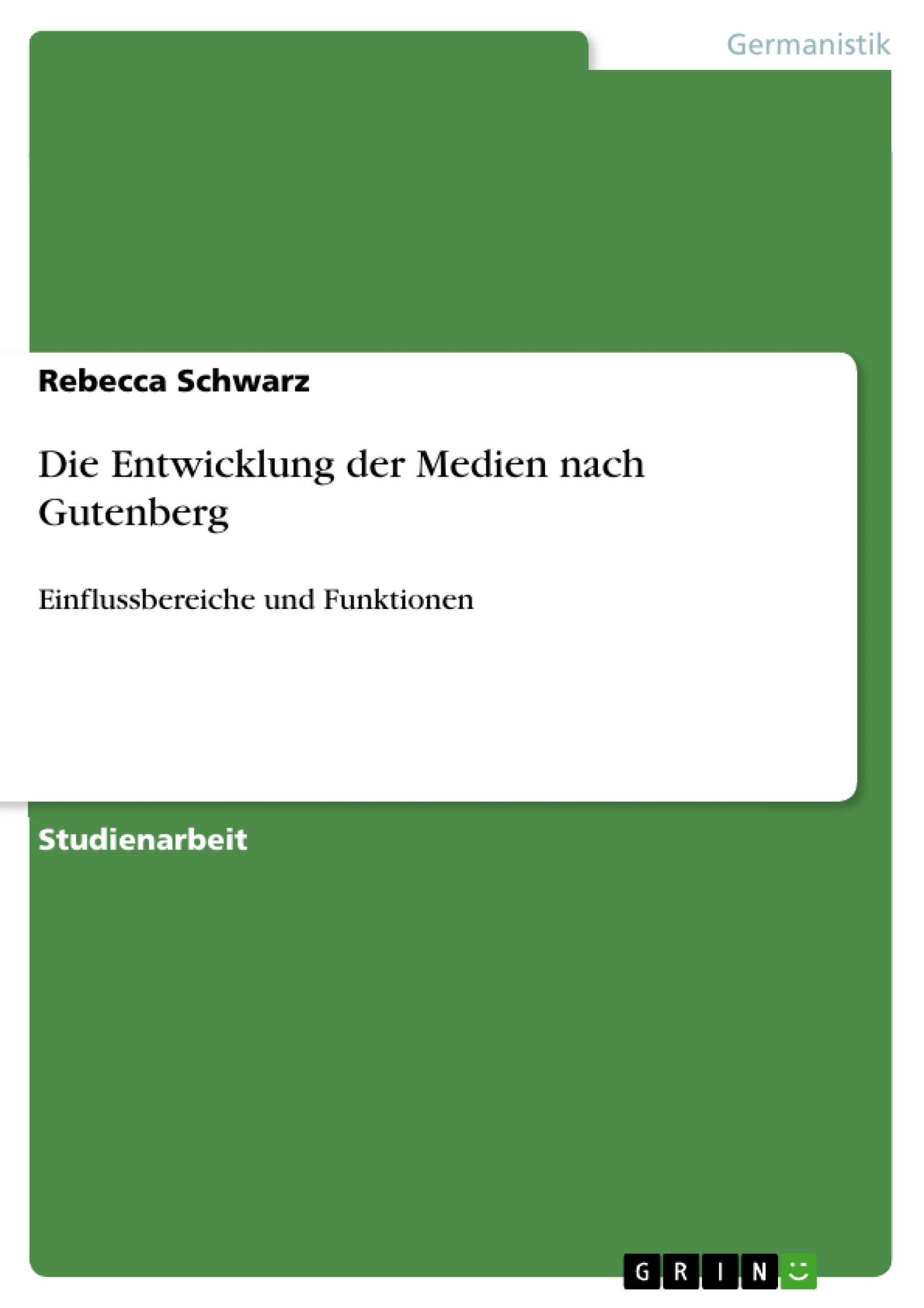Das 15. Jahrhundert zeichnet sich durch wesentliche Veränderungen im gesellschaftlichen Leben Europas aus: Martin Luther wandelte mit seiner Reformation das religiöse Denken und brachte eine neue Konfession der katholische Kirche hervor. Die Menschen richteten ihren Blick wieder auf die Antike aus und orientierten sich an deren Idealen. Durch die Bauernkriege sowie dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Mehrheit der Bürger mittellos. Dennoch verbesserte sich die Wirtschaft der Städte im Spätmittelalter rasant, vor allem der Handwerker- und Kaufmannsstand erfuhr hierbei einen raschen Aufschwung. Der Fernhandel dehnte sich weiter aus. Es kam zur Veranstaltung von globalen Märkten, auf denen weit ausgreifende Handelsgesellschaften notwendig waren. Diese Entwicklung sorgte dafür, dass das bisher vorhandene Botenwesen, das lediglich auf Teilöffentlichkeiten reduziert war, für die Informationsübermittlung nicht mehr ausreichte. Der Merkantilismus hatte eine wachsende Nachfrage nach fachsprachlichen und literarischen Wissen zur Folge.
Doch erst die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, machte es möglich, den zunehmenden Bedarf an Texten zu befriedigen. Der Buchdruck stellt eine bedeutende Begebenheit in der europäischen Kulturgeschichte dar. Texte aus allen Bereichen des täglichen Lebens konnten nun beliebig oft kopiert und unter den Menschen verbreitet werden. Erst diese Medienrevolution ermöglichte es Reformatoren wie Luther und Johannes Calvin, ihre religiösen Ansichten zu verbreiten – denn die katholische Kirche war trotz ihrer Macht nicht dazu imstande, die immer weiter um sich greifenden neuen Medien mit einer wirkungsvollen Zensuren zu belegen. Die Weiterentwicklungen in den Medien im 15. Jahrhundert stellen somit auch eine Grundlage für die gesellschaftlichen Wandlungen zu dieser Zeit dar, oder steuerten zumindest einen wichtigen Teil zu ihrer Entstehung bei. Neue Kommunikationsstrukturen setzten sich unter der Bevölkerung Europas durch. Doch wie genau veränderten sich die „alten“ Medien mit der Entwicklung des Buchdrucks durch Gutenberg und welche Aufgaben erfüllten die „neuen“ Medien wie Flugblatt, Flugschrift und die Zeitung? Welchen Beitrag leisteten sie zur Reformation, dem Humanismus und dem Frühkapitalismus? Die folgende Arbeit soll die Entwicklung der Medien nach der Medienrevolution näher erläutern und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen näher aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Europa im Wandel
3. Johannes Gutenberg
4. Tiefgreifende Veränderungen
4.1 Die Reformation
4.2 Die katholische Kirche und der Buchdruck
5. Pressegeschichte
5. 1 Die Zeitung
5. 2 Flugblatt und Flugschrift
5.3 Das Buch
5.4 Ländliches Medium: der Kalender
6. Der Humanismus
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis