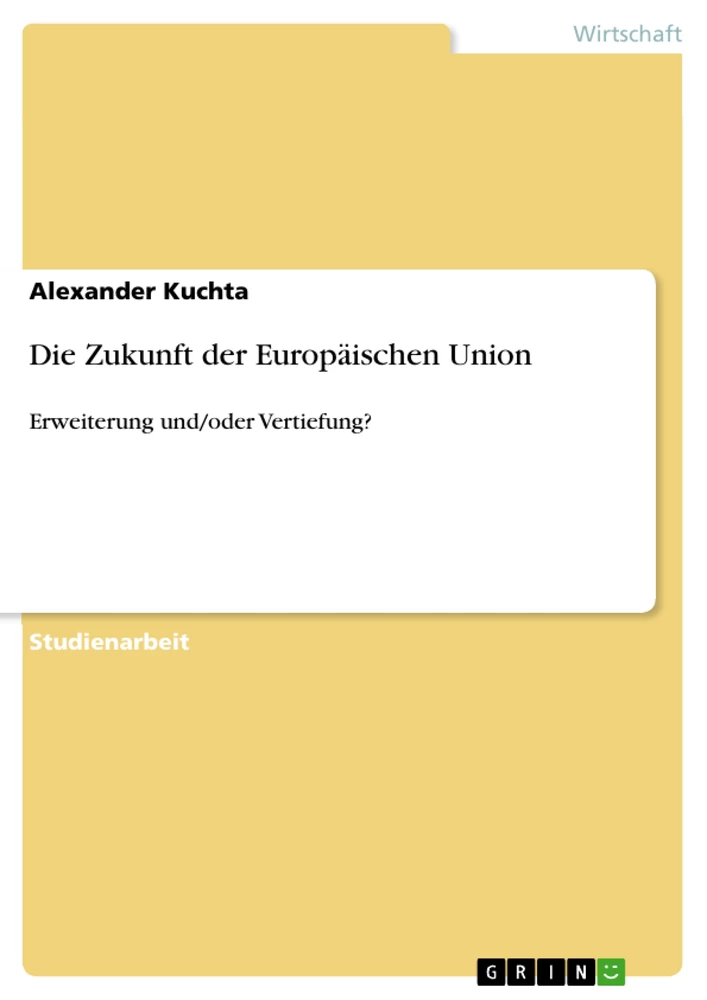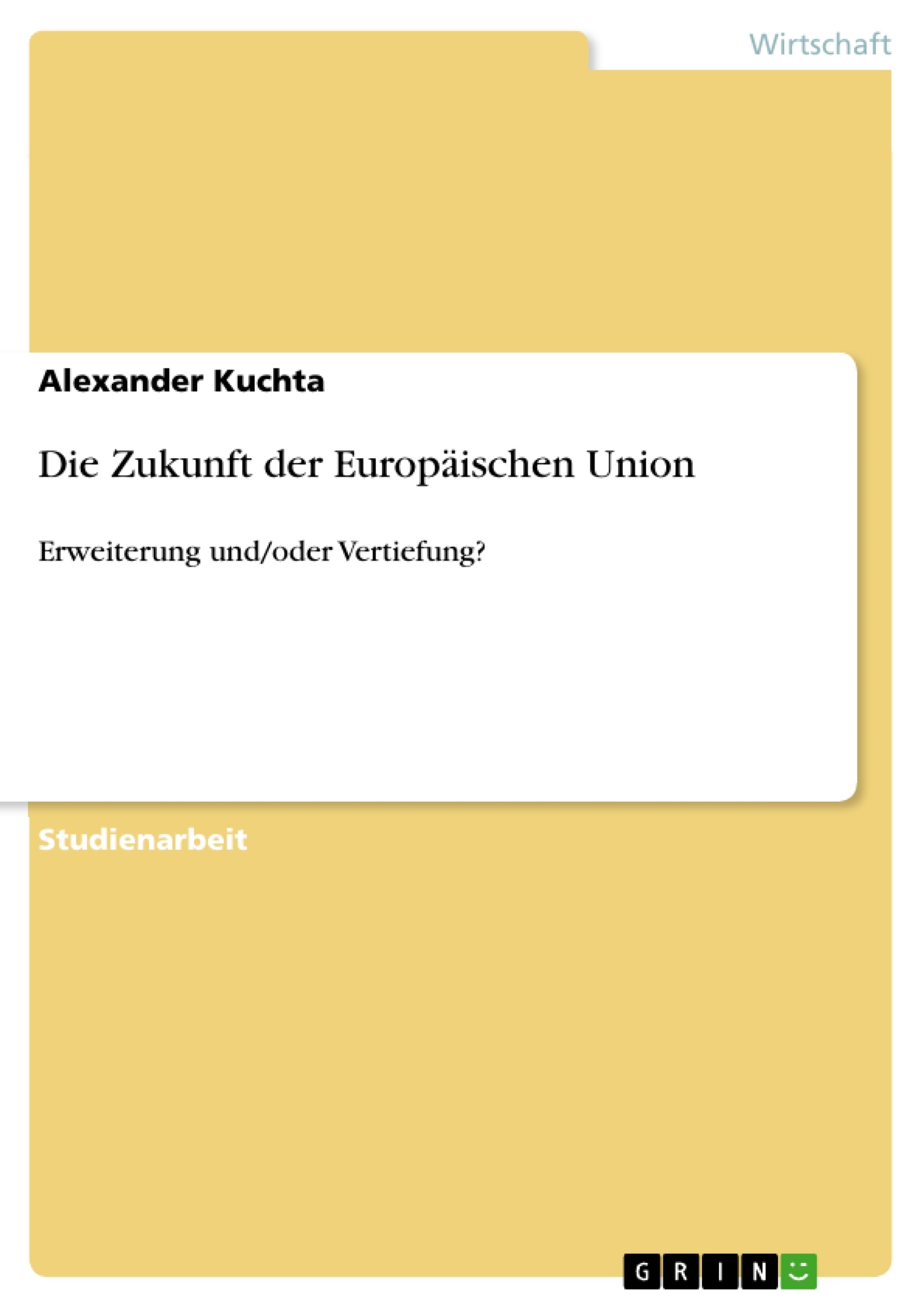Die Europäische Union - Gegründet im Jahre 1957, hat sie in den letzten 50 Jahren eine
große Anziehungskraft auf alle europäischen Staaten ausgestrahlt. Die damals eher auf
Friedensicherung angelegte Montanunion, hat sich damit sukzessiv zu einem der
erfolgreichsten Integrationsprojekte weltweit entwickelt. Doch der Motor der
unbedingten Integration stockte in Folge der letzten Osterweiterung. Die gigantische
Erweiterung um 12 neue Mitgliedsstaaten und der Aussicht auf neue
Erweiterungsrunden, hat die Europäische Union vor ihre bislang größte Zerreißprobe
gestellt. Der letzte große Integrationsversuch in Form der gemeinsamen Verfassung
schlug an den Referenden in Holland und Frankreich fehl. Die in der Union der Sechs
veranlagten Entscheidungsfindungsmechanismen haben ihre Steuerungsfähigkeit über
die Union verloren und auch die Reformen im Rahmen des Reformvertrags von Lissabon
haben wenig an der Beherrschbarkeit der Union geändert. Eine neue Erweiterung oder
Vertiefung der Europäischen Union scheint keinen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben.
Ist die Europäische Union an ihrem Scheideweg angekommen, an dem sie sich
entscheiden muss für Integration oder Erweiterung oder bietet sich die Möglichkeit eines
Mittelweges? Im Rahmen dieser Seminararbeit werde ich mittels Theorien des
Fiskalföderalismus die jetzige Situation der Europäischen Union untersuchen und
versuche, eine Einschätzung der weiteren Integrations- und Erweiterungsfähigkeit anhand
clubtheoretischer Überlegungen herauszuarbeiten. Auch werde ich versuchen eine
Erklärung für die sich immer stärker manifestierenden Zentralisierungstendenzen zu
finden. Im Weiteren werde ich die verschiedenen Spielarten der Integration erläutern und
im Folgenden das Instrument der Verstärkten Zusammenarbeit näher betrachten. Dann
werde ich eine kritische Beurteilung der jetzigen Integration unter clubtheoretischen und
fiskalföderalistischen Gesichtspunkten vornehmen und zum Abschluss Politikfelder
aufzeigen, welche für sich als neue Integrationsmöglichkeiten anbieten.
1. Inhalt
1. Einleitung
2. Die Theorie des Fiskalföderalismus - Arbeitsgrundlage für die spätere Beurteilung
2.1 Öffentliche Güter
2.2 Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz
2.3 Das Dezentralisierungs-Theorem
2.4 Die Clubtheorie
3. Die möglichen Folgen einer neuen Erweiterungsrunde auf die weitere Entwicklung der Europäischen Union
3.1 Eine Definition von Integration und Erweiterung unter Einbeziehung clubtheoretischer Überlegungen
3.2 Die Frustrationskosten einer Abstimmung
3.3 Die zunehmende Zentralisierung als Folge des Stimmtauschs
3.4 Die Aufnahme weiterer Mitglieder unter clubtheoretischer Betrachtung
4. Modelle zur Realisierung der Flexibilisierung der europäischen Integration
4.1 Die abgestufte Integration und das Europa der zwei Geschwindigkeiten
4.2 Ein Europa der variablen Geometrie und die Idee eines Kerneuropa
4.3 Europa à la Carte
4.4 Das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit
5. Welche Vertiefungsbereiche bieten sich für die Europäische Union an?
5.1 Eine kritische Bewertung der aktuellen Aufgaben der Europäischen Union
5.2 Mögliche neue Aufgabengebiete für die Europäische Union
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis