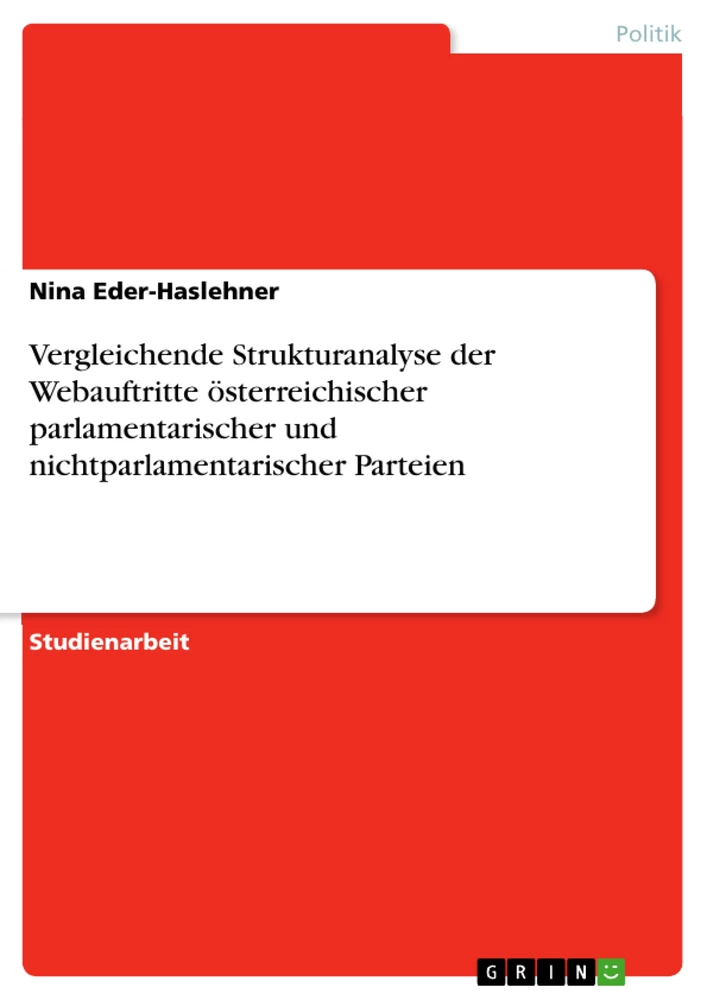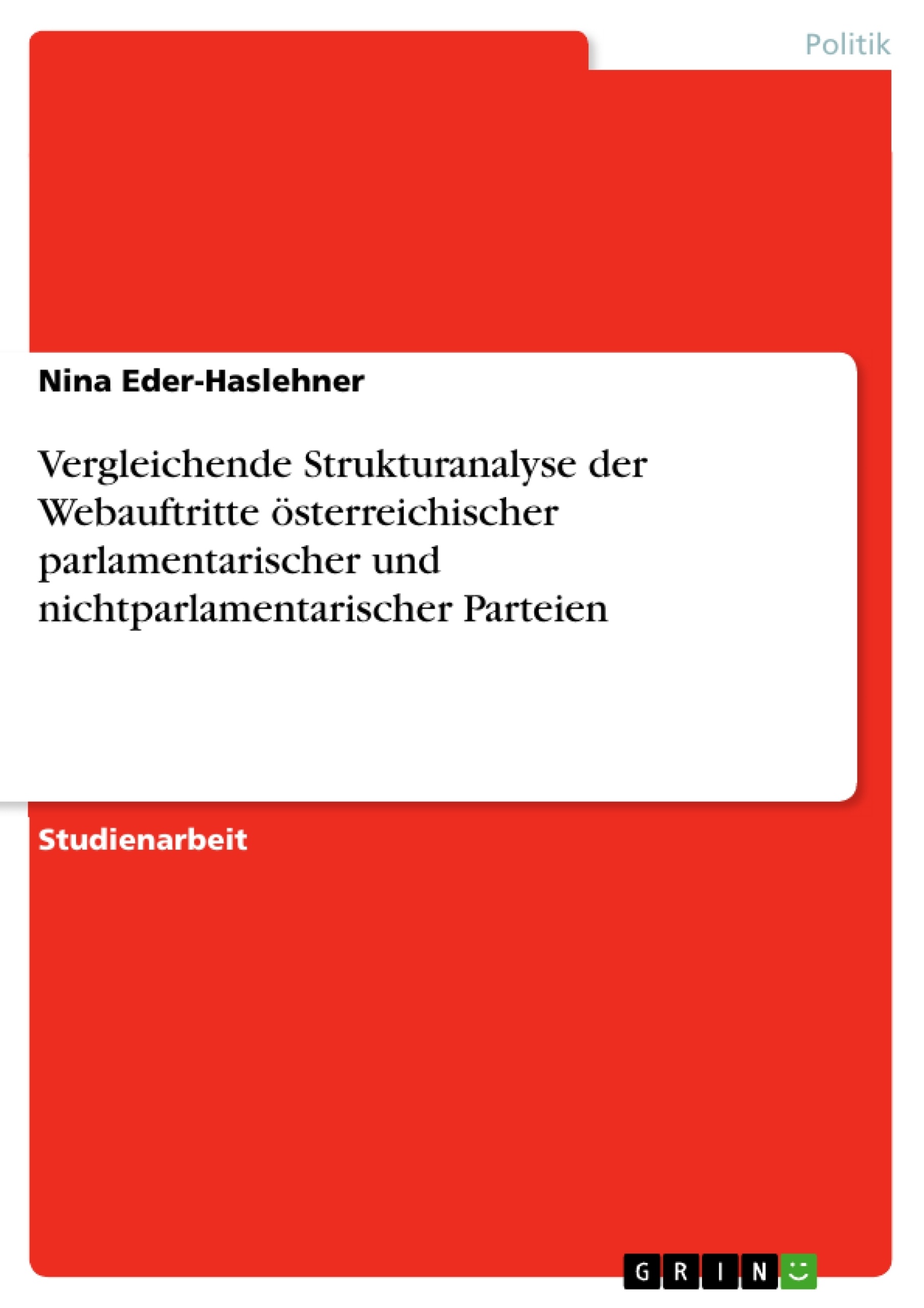Als Georg W. Bush über „rumours on the, uh, internets“ im US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 berichtete, war dies bezeichnend für den Mangel an Verständnis, der über das neue Medium Internet vorherrschte bzw. immer noch vorherrscht, trotz seiner stetig steigenden Wichtigkeit. (The Economist, 2001: 11) Das Internet hat in den letzten Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs für sich verzeichnen können. In Österreich verfügten rund siebzig Prozent aller Haushalte im Jahr 2009 über einen Internetzugang. Im Vergleich zum Jahr 2002 bedeutet dies mehr als eine Verdoppelung. (Statistik Austria, 2009). Das Internet ist also zu einem Alltagsmedium und zu einem zentralen Informationsinstrument geworden. Wie Sartori (1976: 24) feststellte sind die BürgerInnen in modernen Demokratien durch und von Parteien repräsentiert und können vor allem als Mittel der Kommunikation gesehen werden. (Sartori 1976: 28). In dieser Seminararbeit soll aufgrund der beiden Tatsachen, dass das Internet so zentral geworden ist und es Parteien sind, die die Repräsentation der WählerInnen übernehmen, untersucht werden, wie österreichische Parteien das Internet im Allgemeinen und ihre eigenen Webauftritte im Speziellen nutzen um mit den BürgerInnen zu interagieren.
In Zusammenhang von Parteien und Internet wurden in den vergangen Jahren folgende, sich gegenüberstehenden, Thesen formuliert:
Die Normalisierungsthese geht davon aus, dass das Verhältnis von Parteien und dem Internet, sowie seinen dazugehörigen Technologien, wie etwa Email usw., zu keinen dramatischen Änderungen in der aktuellen, sozio-politischen Ordnung führen wird, sondern diese Ordnung vielmehr absorbiert und die bereits bestehenden Bias reproduziert werden. (Ward, Gibson und Lusoli, 2003: 652)
VertreterInnen der Innovationsthese hingegen, glauben vielmehr, dass aufgrund der neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets, die sich vor allem in Interaktivität, Multimedialität und der enormen Informationskapazität ausdrücken, es zu einem fundamentalem Wandel in der Politikpräsentation kommen wird.(Schweitzer, 2008: 450)
Die folgende Seminararbeit untersucht diese Debatte in einem auf Österreich bezo-genen Kontext, für den es bisher in diesem Zusammenhang nur sehr wenig empiri-sche Untersuchungen gab. Mit Hilfe einer vergleichenden Strukturanalyse soll fest-gestellt werden, wie österreichische Parteien die verschiedenen Möglichkeiten, die ein eigener Webauftritt bietet, nützen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Parteien, politische Kommunikation und das Internet
2.1 Der Einfluss der neuen Medien auf die Meinungsbildungsfunktion
3 Methode und verwendete Daten
4 Ergebnisse der Strukturanalyse
4.1 Informationsfunktion:
4.1.1 Parlamentarische Parteien:
4.1.2 Nichtparlamentarische Parteien
4.1.3 Insgesamt
4.2 Partizipationsfunktion
4.2.1 Parlamentarische Parteien
4.2.2 Nichtparlamentarische Parteien
4.2.3 Insgesamt
4.3 Mobilisierungsfunktion
4.3.1 Parlamentarische Parteien
4.3.2 Nichtparlamentarische Parteien
4.3.3 Insgesamt
4.4 Vernetzungsfunktion
4.4.1 Parlamentarische Parteien
4.4.2 Nichtparlamentarische Parteien
4.4.3 Insgesamt
4.5 Servicefunkton
4.6 Usability / Benutzerfreundlichkeit
4.6.1 Parlamentarische Parteien
4.6.2 Nichtparlamentarische Parteien
4.6.3 Insgesamt
5 Conclusio
6 Literaturverzeichnis:
7 Abbildungsverzeichnis
8 Appendix