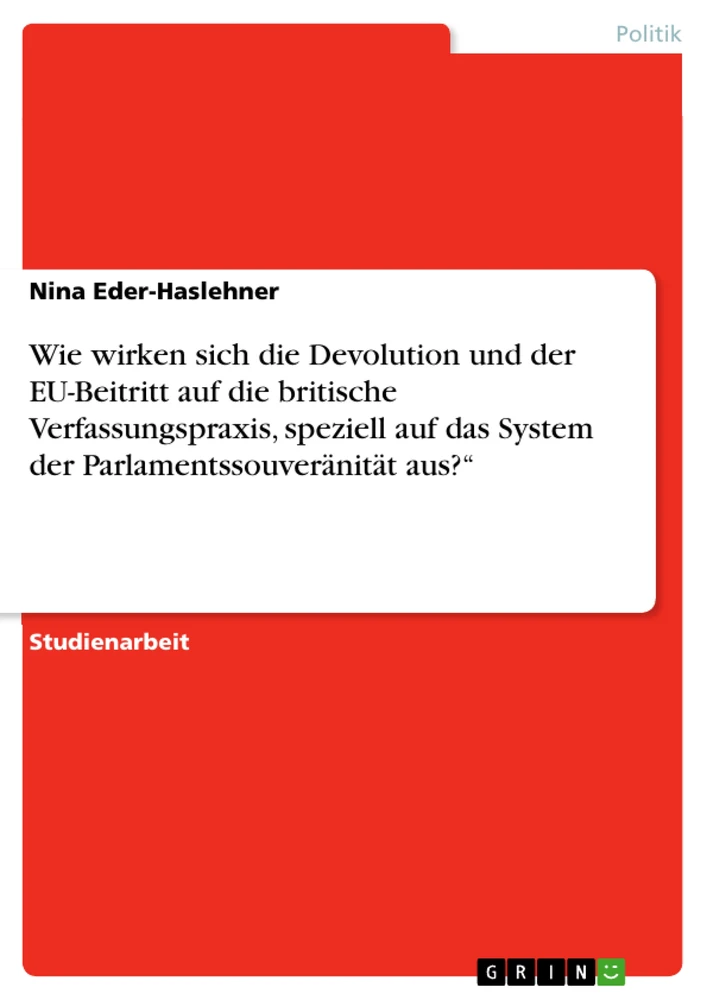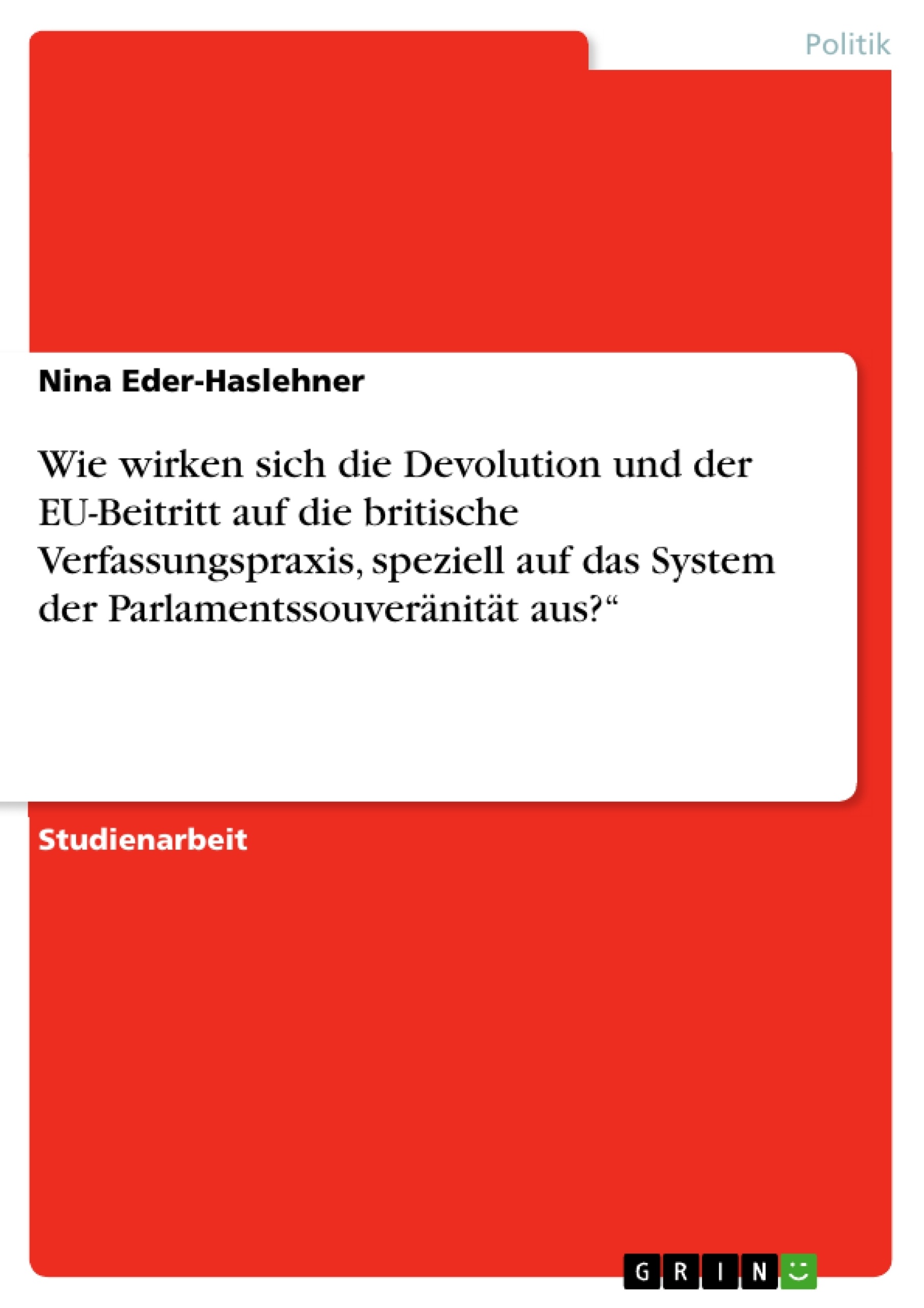Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Das Einzigartige am politischen System der britischen Insel (mit Nordirland) ist zum einen die scheinbar nicht kodifizierte Verfassung in einem funktionierenden, demokratischen System und zum anderen vor allem die Souveränität des Parlaments im Gegenzug zum in Kontinentaleuropa vorherrschenden System der Volkssouveränität. Durch den Beitritt des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Union 1973 und durch die Politik der Devolution (vor allem seit den späten Neunziger Jahren) stellen sich die Fragen, in wie weit durch diese zwei wichtigen, politischen Aktionen die britische Verfassungspraxis, vor allem aber die Parlamentssouveränität, verändert worden sind und ob Großbritannien noch als Einheitsstaat, der zentral vom Parlaments- und Regierungssitz London aus regiert wird, bezeichnet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Die britische Verfassung im groben Überblick:
Definition Parlamentssouveränität:
Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union
Wie wirkt sich die EU-Mitgliedschaft auf die britische Verfassungspraxis aus?
Was ist die Devolution?
Wie wirkt sich die Devolution auf die britische Verfassungspraxis aus?
Vom Einheitsstaat zum Föderalstaat?
Schlussfolgerungen:
Literaturverzeichnis: