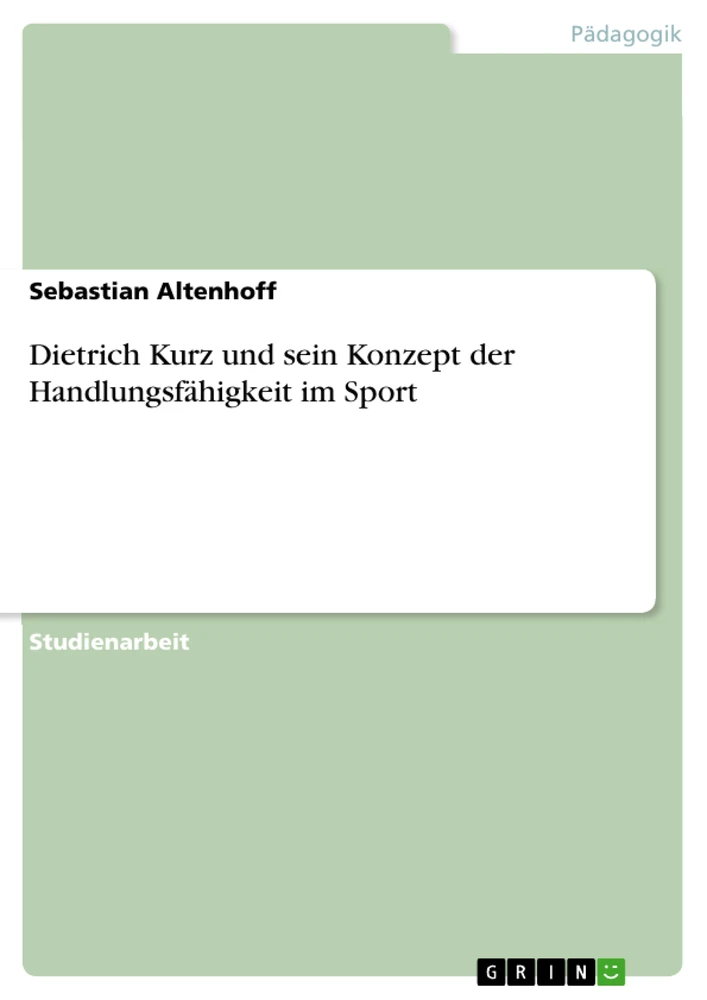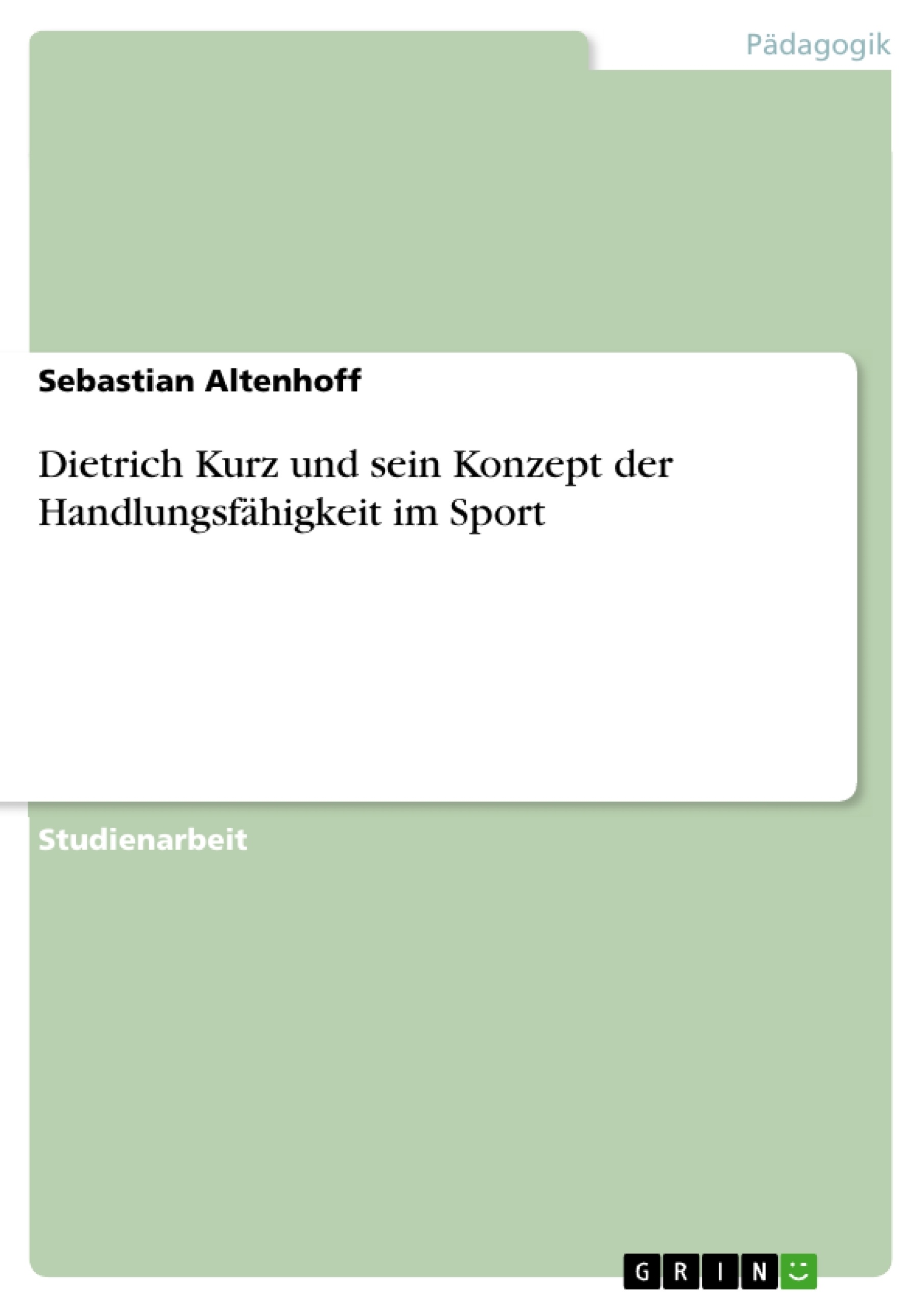Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Handlungsfähigkeit im Sport von Dietrich Kurz. Zu Beginn stelle ich den Ausgangspunkt seiner Überlegungen dar, die Entwicklung von sechs Motivkomplexen bzw. Sinnrichtungen, unter denen Sport seiner Ansicht nach betrieben werden kann. Diese leiten über zur Idee der Handlungsfähigkeit und der Forderung nach einem mehrperspektivischen Sportunterricht. Den Abschluß bildet ein Kommentar meinerseits, in dem problematische Punkte kritisch beleuchtet und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Handlungsfähigkeit im Sport
2.1 Der Sinn sportlicher Situationen
2.2 Die sechs Motivkomplexe
2.3 Zwischenbilanz
2.4 Von den Sinnrichtungen zur Handlungsfähigkeit
2.5 Mehrperspektivität am Beispiel der Leichtathletik
3 Kritischer Kommentar
4 Literaturverzeichnis