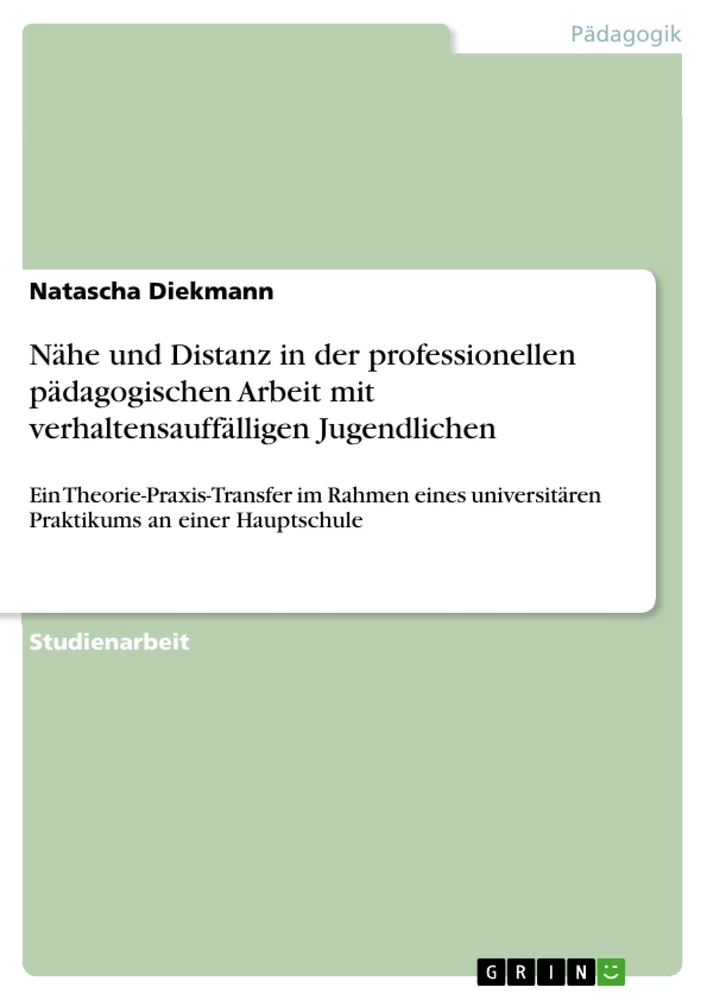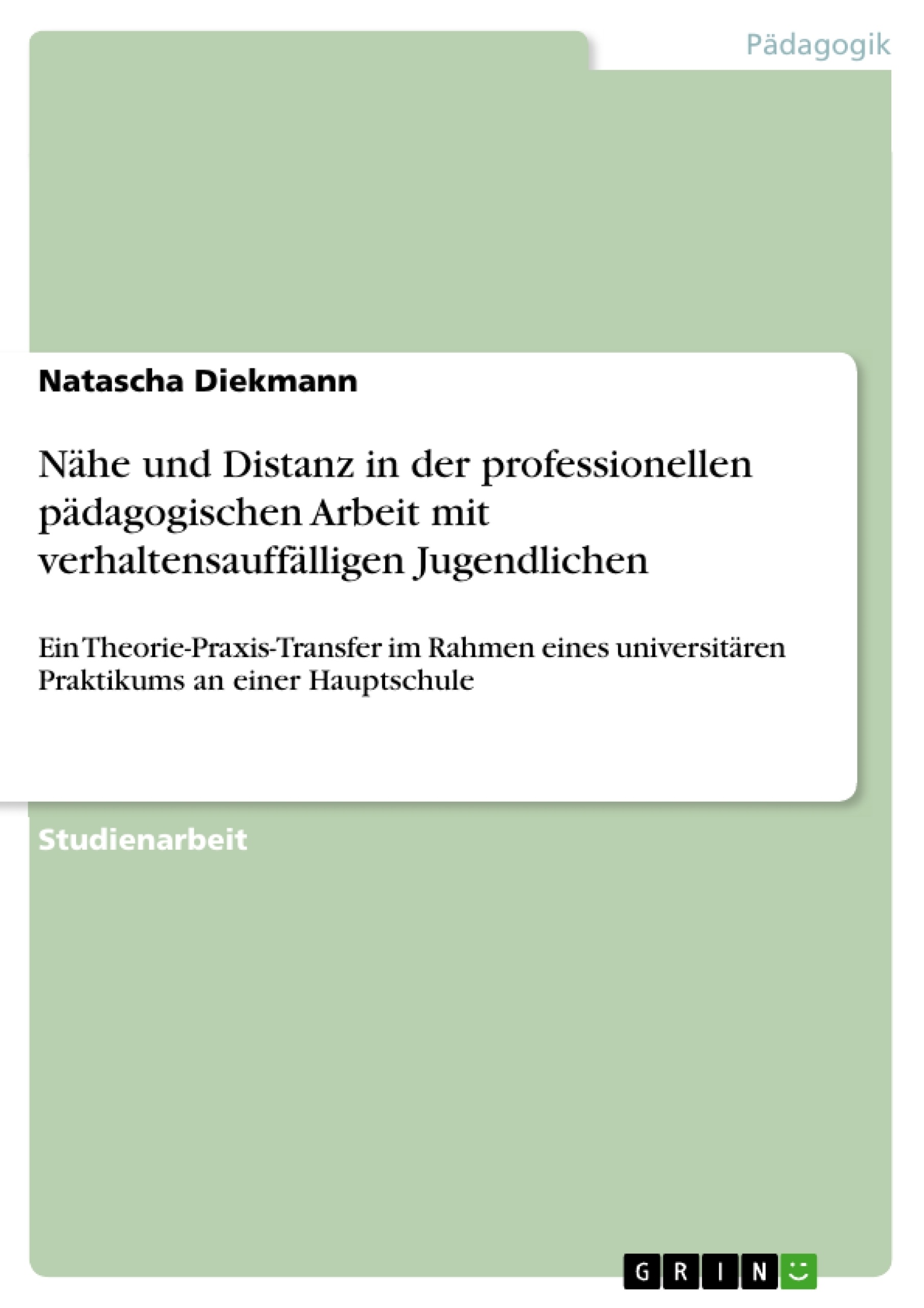Nähe und Distanz stellen eine elementare Problematik in der professionellen pädagogischen Arbeit dar. In der hier vorliegenden Arbeit soll die Thematik anhand einer qualitativen Fallanalyse im Rahmen eines Praktikums an einer Hauptschule veranschaulicht werden. Zu diesem Zweck wird der Fall zunächst in seinen Grundzügen skizziert um anschließend einen Theorie-Praxis-Transfer vor diesem Hintergrund zu durchzuführen.
Der theoretische Rahmen der Arbeit besteht zunächst aus einer allgemeinen Darstellung der Nähe-und-Distanz-Problematik, welche als Basis für die darauf folgenden Ausführungen dienen wird. Für den Theorie-Praxis-Transfer werden zwei verschiedene theoretische Ansätze zu der Thematik verwendet. Zum einen der theoretische Ansatz der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit und zum anderen die psychoanalytische Pädagogik. Diese beiden Ansätze bieten zwei sehr unterschiedliche, sich jedoch ergänzende, Betrachtungsweisen von Nähe und Distanz. Die psychoanalytische Pädagogik ist im Rahmen dieser Arbeit als hoch interpretativ zu betrachten.
In dem letzten Teil der Arbeit werden Handlungsalternativen schlussgefolgert, welche auf den theoretischen Erkenntnissen und dem Theorie-Praxis-Transfer basieren. Der Ausblick bezieht sich auf präventive Maßnahmen und bietet Ansätze für bereits praktizierende PädagogInnen.
Diese Arbeit soll exemplarisch für mögliche Probleme in der Beziehung zwischen PädagogInnen und KlientInnen sensibilisieren und auf oft als trivial deklarierte Aspekte und ihrer Bedeutung in der pädagogischen Arbeit hinweisen.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Falldarstellung und Fokussierung
2.1 Schilderung des Falls
2.1.1 Schulischer Alltag
2.1.2 Hintergrundinformationen
2.1.3 Soziografische Darstellung
2.2 Fokussierung
3. Verknüpfung von Fall und wissenschaftlichen Theorien
3.1 Nähe und Distanz als Problematik der pädagogischen Profession
3.2 Nähe und Distanz in der lebensweltorientierten sozialen Arbeit
3.3 Nähe und Distanz in der psychoanalytischen Pädagogik
3.4 Interpretationen der Beziehungen von Jan Meier zu professionell handelnden Personen auf theoretischer Basis
3.4.1 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
3.4.2 Psychoanalytische Pädagogik
4.Ausblick
5.Literaturverzeichnis