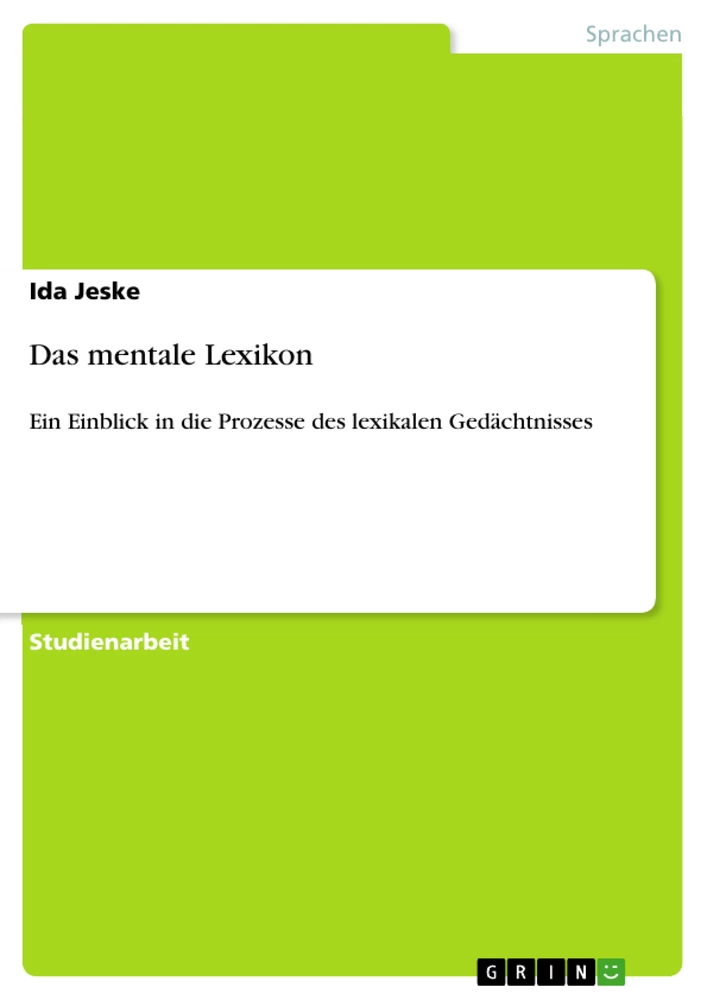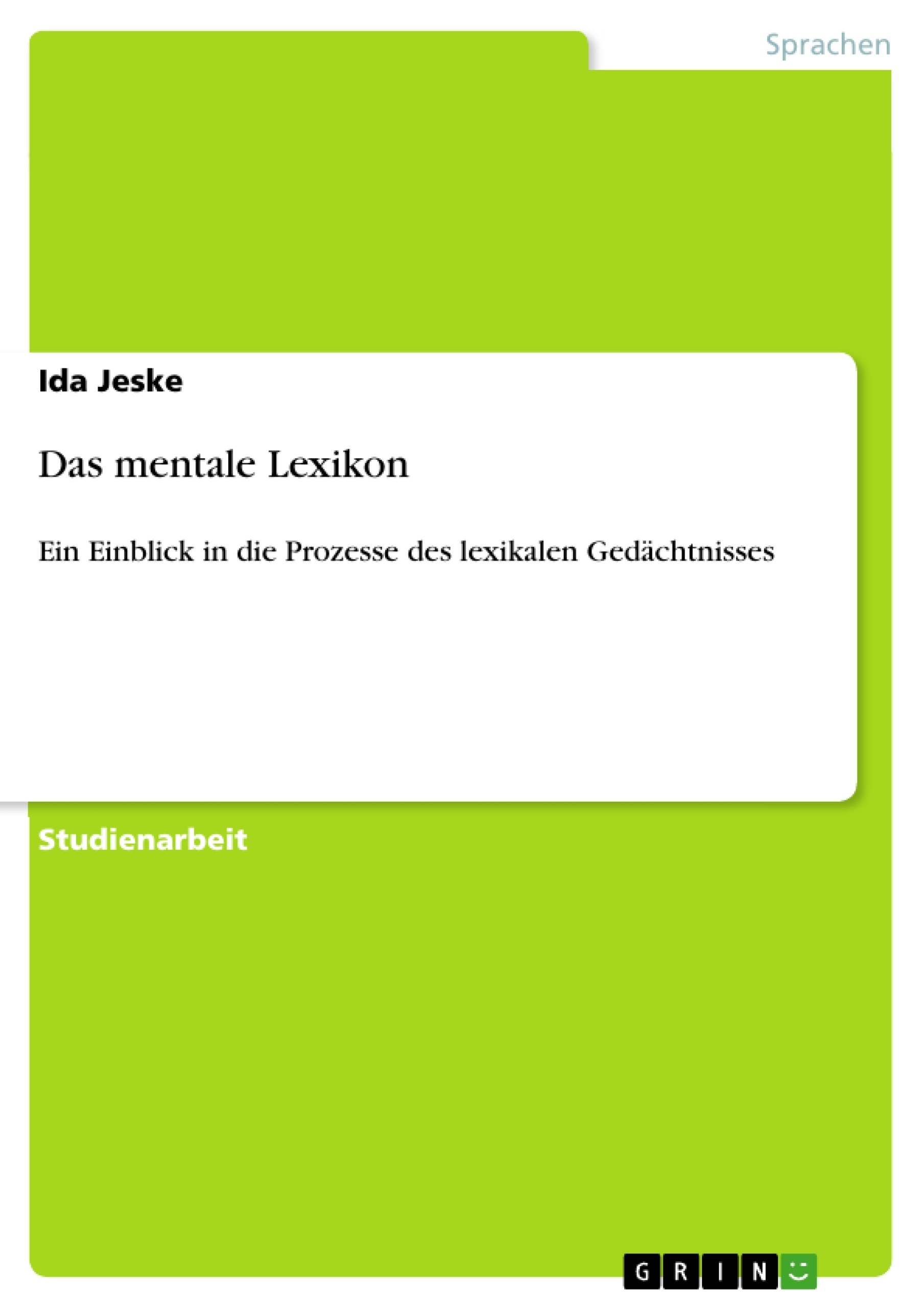Die vorliegende Arbeit widmet sich dem sprachlichen Informationsspeicher des Menschen - dem mentalen Lexikon. Die Grundlage aller sprachlichen Aktivitäten, das sprachliche Wissen, wird in Kapitel zwei unter dem Titel „Woher weiß man, was man spricht“ behandelt, womit eine Basis für die weiteren Erläuterungen zum lexikalen Gedächtnis gelegt wird. Kapitel drei stellt den Versuch dar einen Einblick in die Beschaffenheit, Organisation und Funktion des mentalen Lexikons zu gewähren. Auf Grund der aktuell zahlreichen Theorien zum mentalen Lexikon und infolge des Platzmangels werden in dieser Arbeit ausgesuchte Theorien vorgestellt. Infolgedessen stützen sich die Ausführungen zur Beschaffenheit des mentalen Lexikons, zu den Bedeutungsrepräsentationen und ihrer Struktur auf konnektionistische Theorien. Desweiteren werden Modelle des Zugriffs auf das mentale Lexikon dargelegt, die einen großen Bekanntheitsgrad in der Psycholinguistik besitzen. Die Arbeit soll ein Überblick über und damit ein Verständnis für die kognitiven Prozesse im lexikalen Gedächtnis schaffen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Woher weiß man, was man spricht?
3 Das mentale Lexikon
3.1 Repräsentation von Bedeutungen im mentalen Lexikon
3.1.1 Ein Wort als kognitive lexikalische Einheit
3.1.1.1 Struktur der lexikalischen Einheit im mentalen Lexikon
3.1.2 Das mentale Lexikon als Bedeutungsnetzwerk
3.3 Der Zugriff auf das mentale Lexikon
3.3.1 Modelle der Wahrnehmung von Wörtern
3.3.2 Modelle des Worterkennens
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis