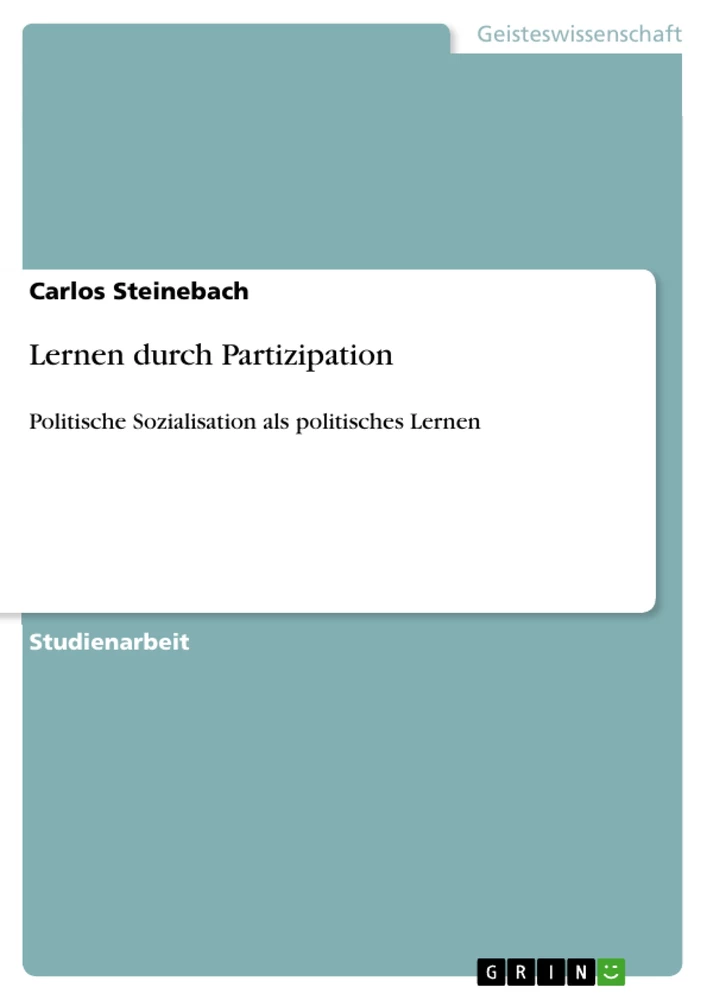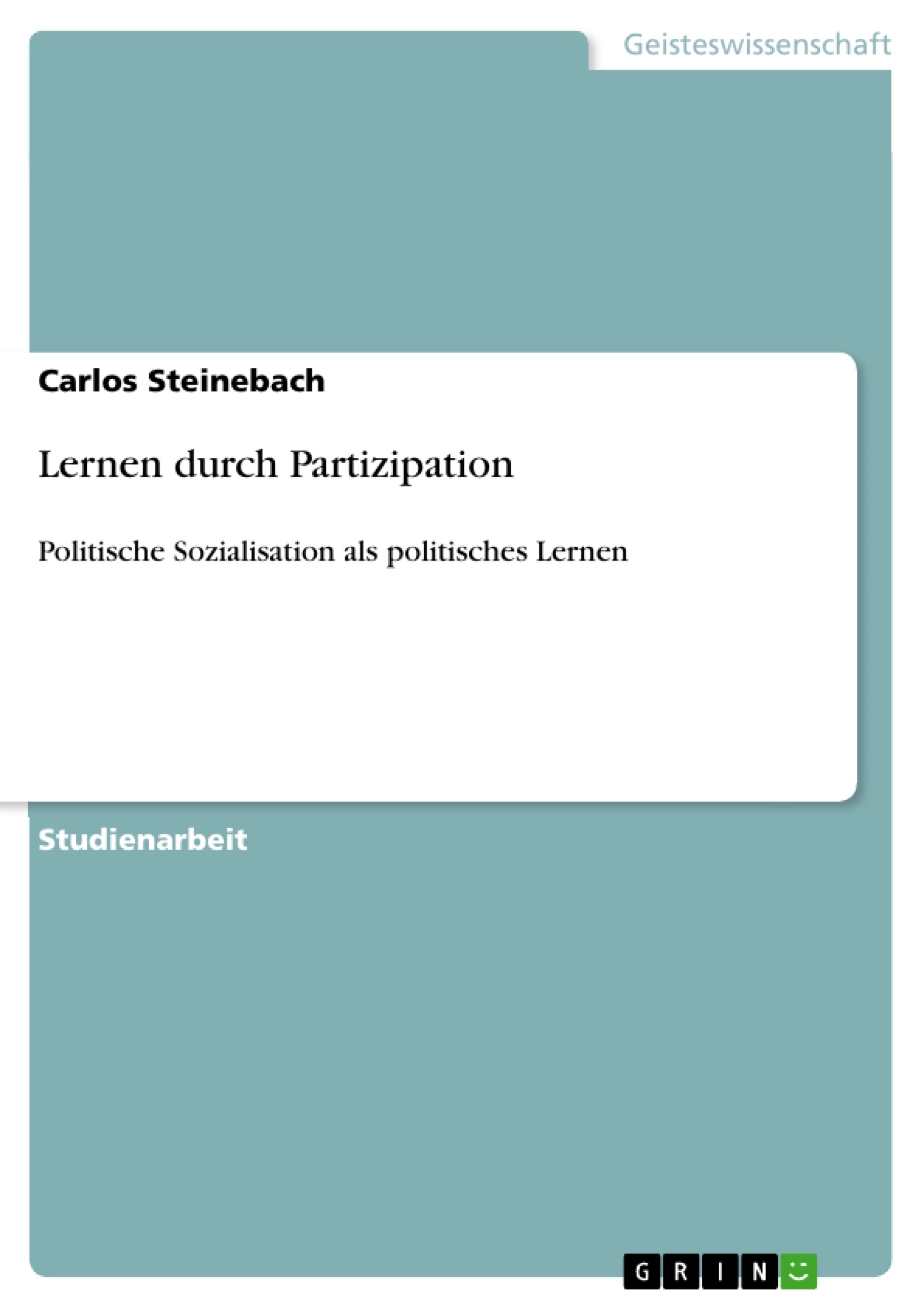„[…]Mit dem Begriff Partizipation [werden] alle Tätigkeiten der Bürger zusammen gefasst, die diese freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen.“ Ausgehend von dieser Begriffsbestimmung stellt sich nun die Frage, wie sich dies in der Praxis umsetzen lässt und welcher äußerer Faktoren es bedarf, um entsprechende Fähigkeiten überhaupt erst zu generieren. Ist die Forderung nach einer breiteren Mitbestimmung mit einer passiven Bürgergesellschaft kompatibel oder leben die meisten Mitglieder unserer Gesellschaft mit ihren „partizipatorischen Ansprüchen über ihren Verhältnissen“? Wie und wodurch kann sicher gestellt werden, dass sich auch kommende Generationen an politischen Entscheidungen beteiligen wollen und es auch können?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wege der politischen Partizipation im 21.Jahrhundert:
Medien, Schule, außerschulische Lernorte
1. Politische Beteiligung und Medien
2. Schule und außerschulische Lernorte
Fazit
Literaturverzeichnis