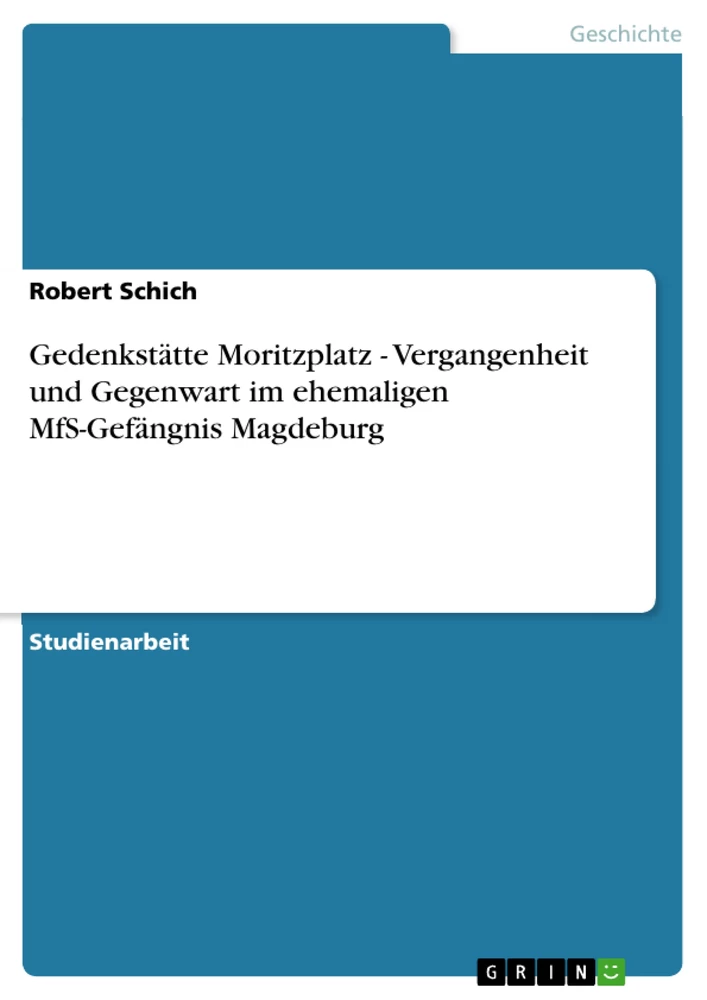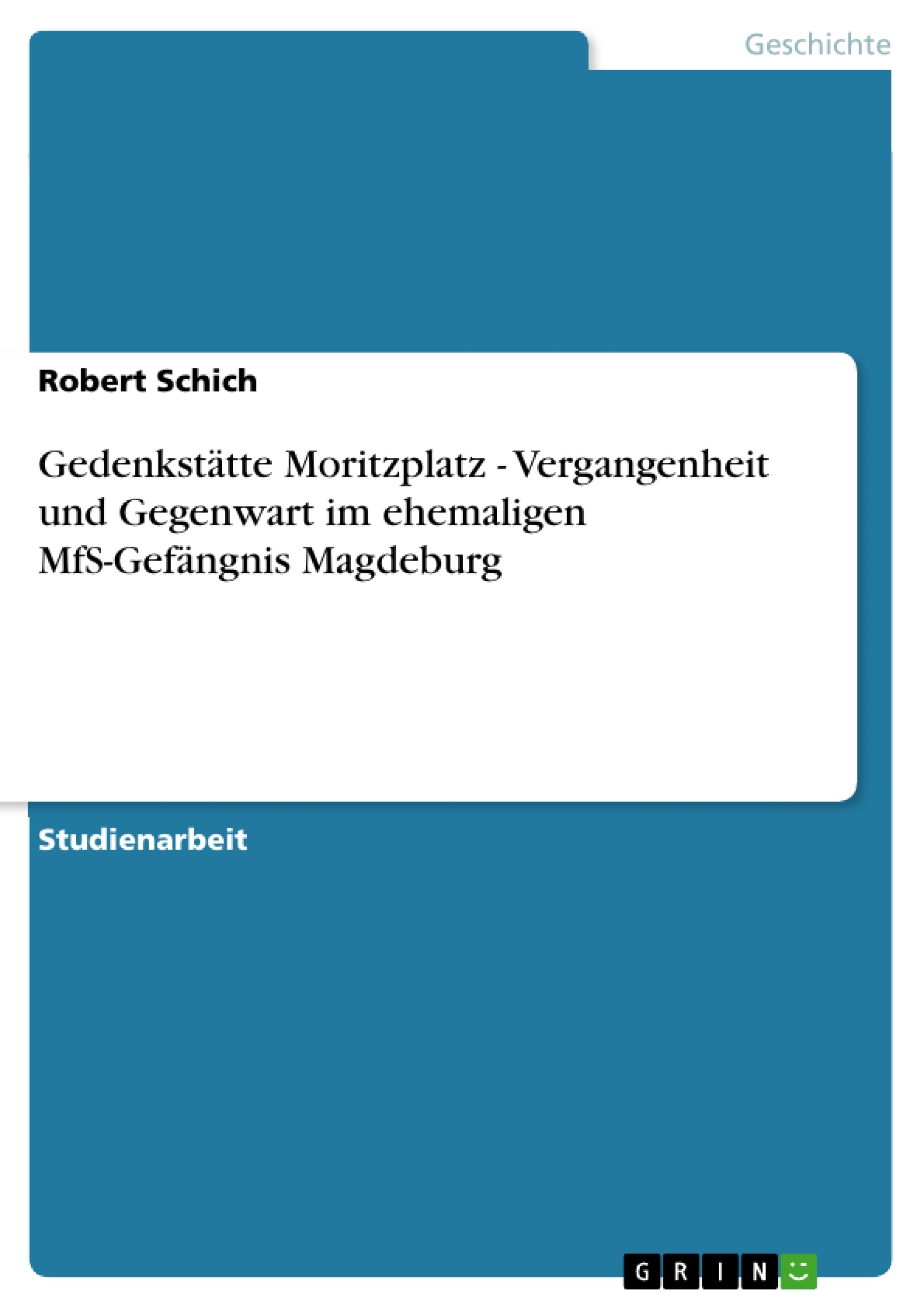Untersuchungen zur Entwicklung der heutigen Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg. Haftbedingungen und Vorgänge in der Haft.
Inhaltsverzeichnis
I. Eidesstattliche Erklärung
II. Einführendes
III. Zur Geschichte der Anstalt bis 1958
IV. Das „MfS“ übernimmt. Die „UHA I.“ entsteht
IV.I Vorgehen gegen „Feinde des Staates“ und gesetzlicher Rahmen
IV.II Haftalltag Ablauf, Ziele, Bedingungen – Erfahrungsberichte
V. Gedenkstätte Moritzplatz 1990 bis 2010
VI. Literaturverzeichnis
VII. Anhang
Ende der Leseprobe aus 18 Seiten
- nach oben