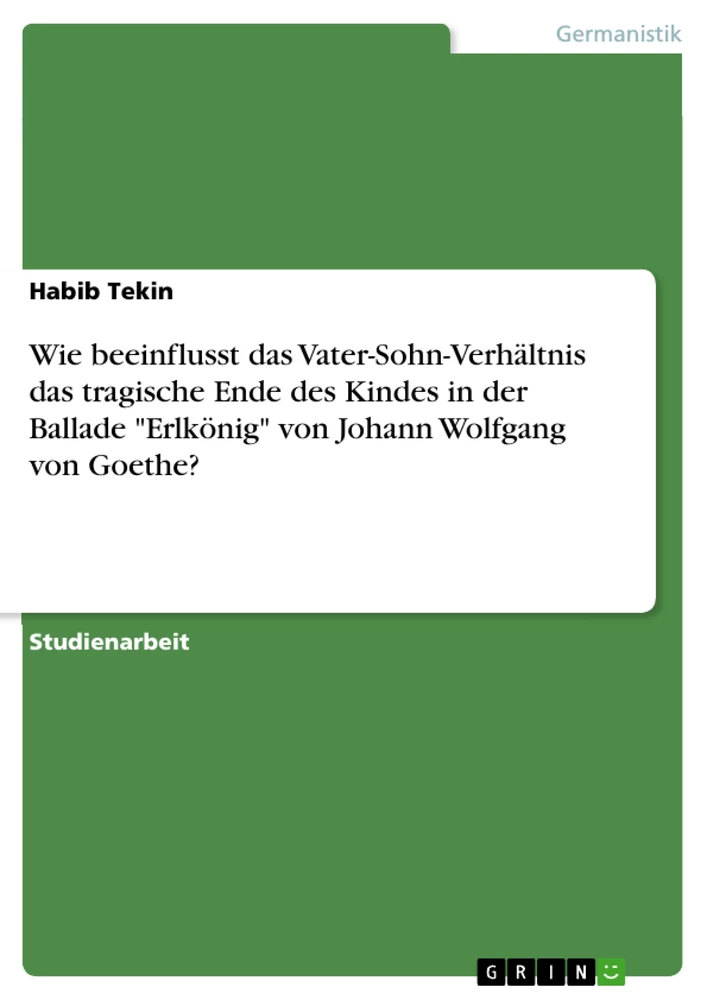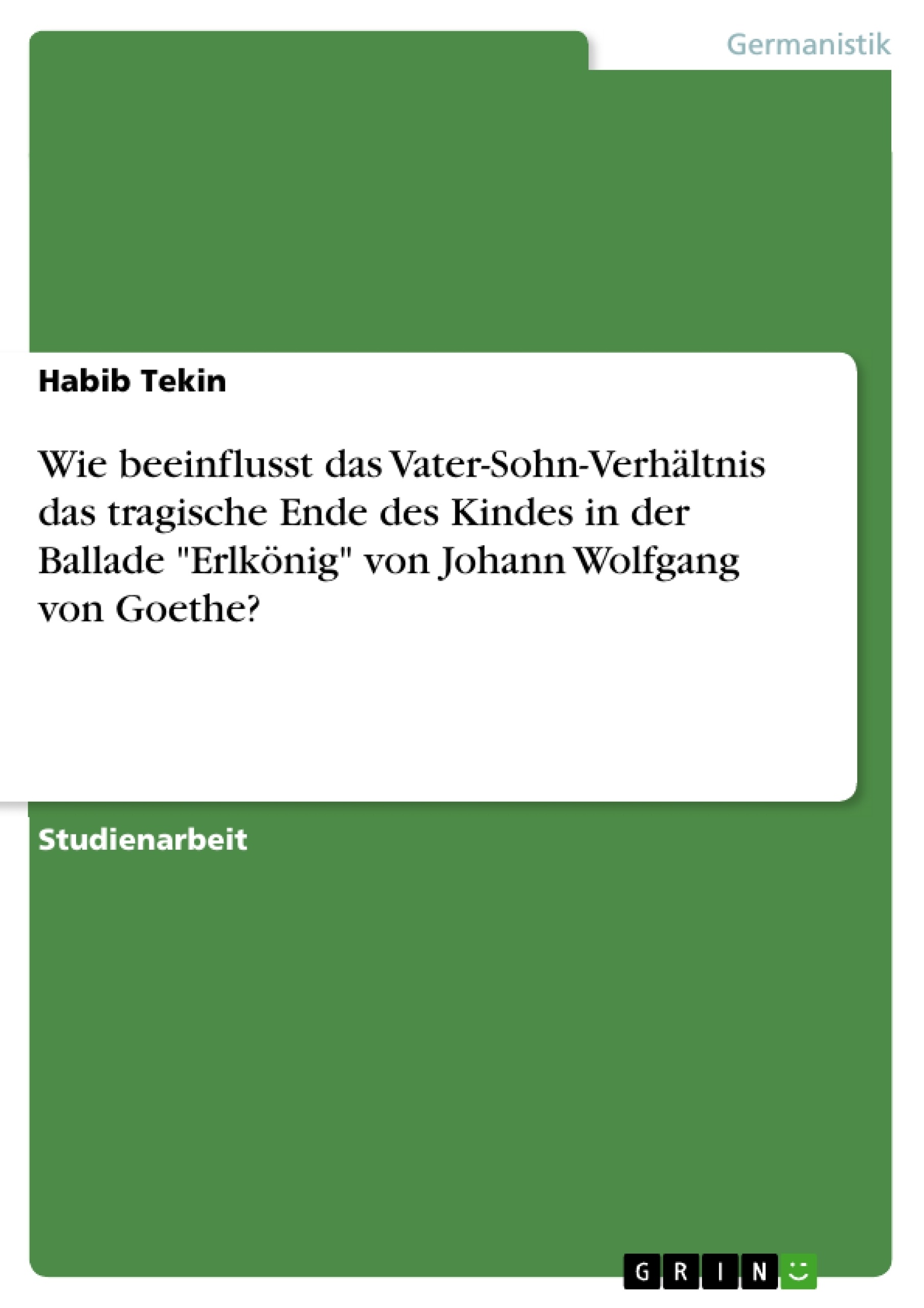Das Inhaltsverzeichnis ist in drei Hauptpunkte, darunter aber auch in Unterpunkte gegliedert. Die eigentliche Schilderung der wissenschaftlichen Arbeit fängt lediglich ab dem zweiten Hauptpunkt an.
Dort gehe ich zunächst auf die zahlreichen Fragen im Gedicht ein, denn diese bewirken viele Unklarheiten. Desweiteren schildere ich das Vater- Sohn- Verhältnis näher. Dabei erfahren Sie die Innenwelt des Vaters und des Knaben und ihre allgemeine Einstellung in einer bestimmten Konfrontation mit einem Problem. Sie werden recht schnell merken, dass der Vater zunächst versucht vernünftig aufklärerisch zu agieren, welches ihm jedoch am Ende nicht mehr gelingt.
Der Sohn leidet an einem nicht bekannten, seelischen bzw. körperlichen Wahn, wobei Charaktere aus der Fantasie des Kindes eine wichtige Rolle spielen.
Letztendlich kollidieren aus verschiedenen Gründen und Einflüssen zwei Welten aufeinander, welche zum Einen die aufklärerisch vernünftige Sichten des Vaters und zum Anderen die phantasiereichen Sichten des Kindes sind.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1. Originaltext
1.2. Kurzkommentar zum Inhaltsverzeichnis
1.3. Begründung der Wahl des Themas
2 Hauptteil
2.1. Fragen im Erlkönig verlangen nach Aufklärung
2.2. Dialoge zwischen Vater und Sohn
2.2.1. Die aufgeklärt vernünftige Reaktion des Vaters auf die Angstzustände des Kindes
2.2.2. Die Bewertung vom Verhalten des Vaters
2.2.3. Der Zusammenstoß zweier Welten als ein Ergebnis mangelnder Vater- Sohn- Kommunikation
3 Schluss
3.1. Fazit
3.2 Die Todesursache