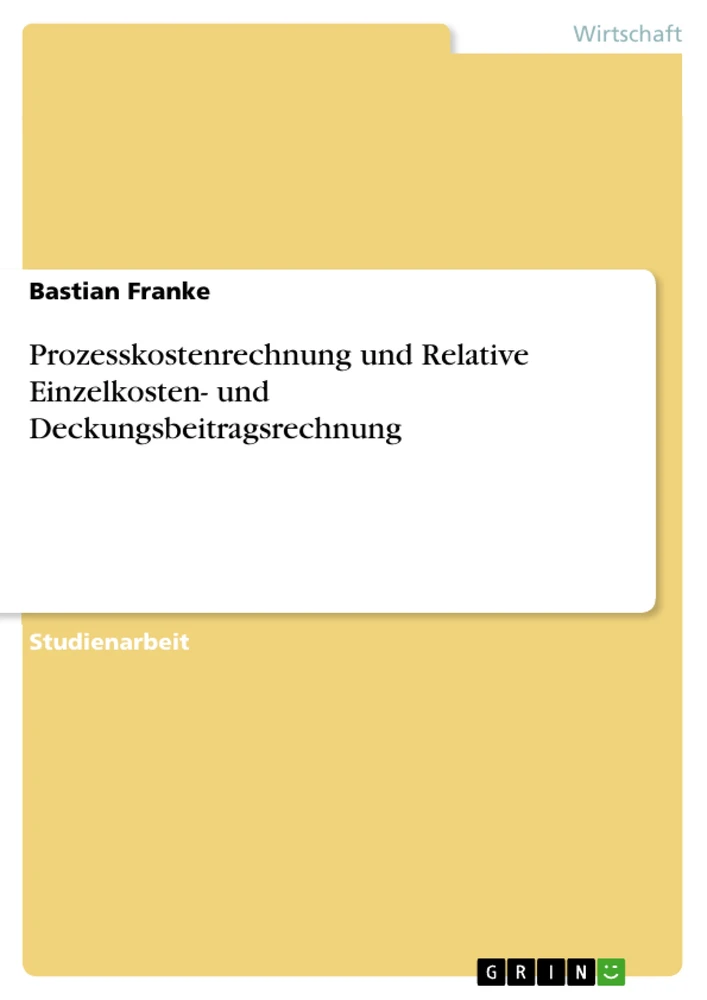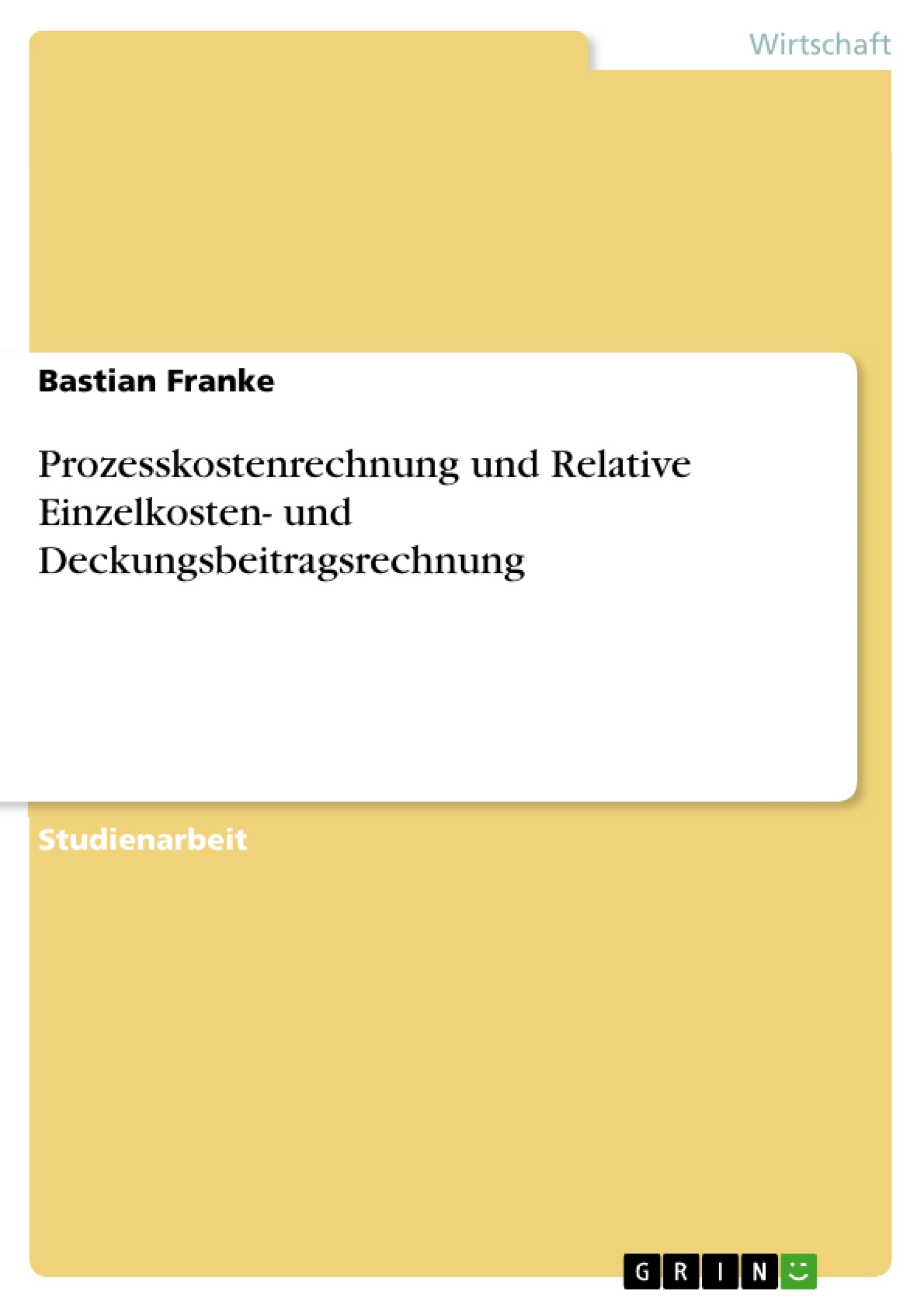Prozesskostenrechnung und Relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung
inklusive Vortragsfolien!!!!!!
Zielgruppe: Studierende der Betriebswirtschaftslehre
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung und Motivation
2. Terminologische Grundlagen
3. Prozesskostenrechnung (PKR)
3.1 Entstehung und begriffliche Abgrenzung
3.2 Grundlagen und Rechnungsziele
3.3 Methodisches Vorgehen
3.3.1 Ermittlung der Prozesse und Zuordnung von
Kosten & Ermittlung der Kostentreiber
3.3.3 Ermittlung der Prozesskostensätze
3.4 Beurteilung der PKR
3.3.4 Zusammenfassung zu Hauptprozessen
4. Relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung
4.1 Grundlagen und Rechnungsziele
4.2 Grundprinzipien der REDR
4.3 Konzeption von Grundrechnung und Sonderrechnung
4.4 Konzeptionelle Schwächen bei der Entscheidungsfindung
4.5 Beurteilung der REDR
5. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Vortragsfolien
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung und Motivation
2. Terminologische Grundlagen
3. Prozesskostenrechnung (PKR)
3.1 Entstehung und begriffliche Abgrenzung
3.2 Grundlagen und Rechnungsziele
3.3 Methodisches Vorgehen
3.3.1 Ermittlung der Prozesse und Zuordnung von Kosten
3.3.2 Ermittlung der Kostentreiber
3.3.3 Ermittlung der Prozesskostensätze
3.3.4 Zusammenfassung zu Hauptprozessen
3.4 Beurteilung der PKR
4. Relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung (REDR)
4.1 Grundlagen und Rechnungsziele
4.2 Grundprinzipien der REDR
4.3 Konzeption von Grundrechnung und Sonderrechnung
4.4 Konzeptionelle Schwächen bei der Entscheidungsfindung
4.5 Beurteilung der REDR
5. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Vortragsfolien