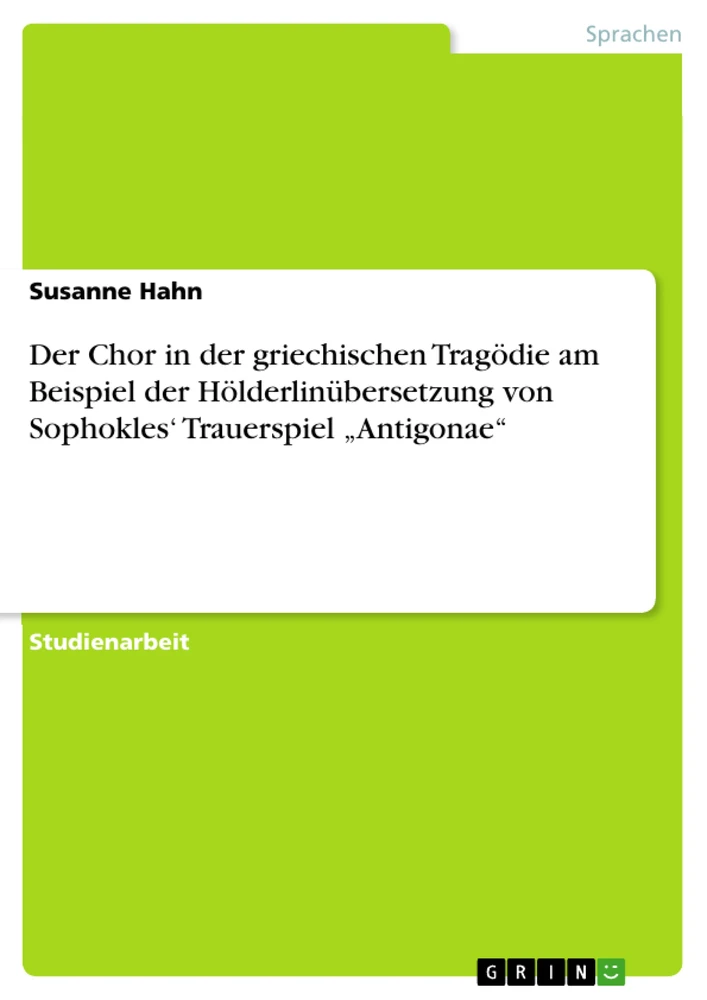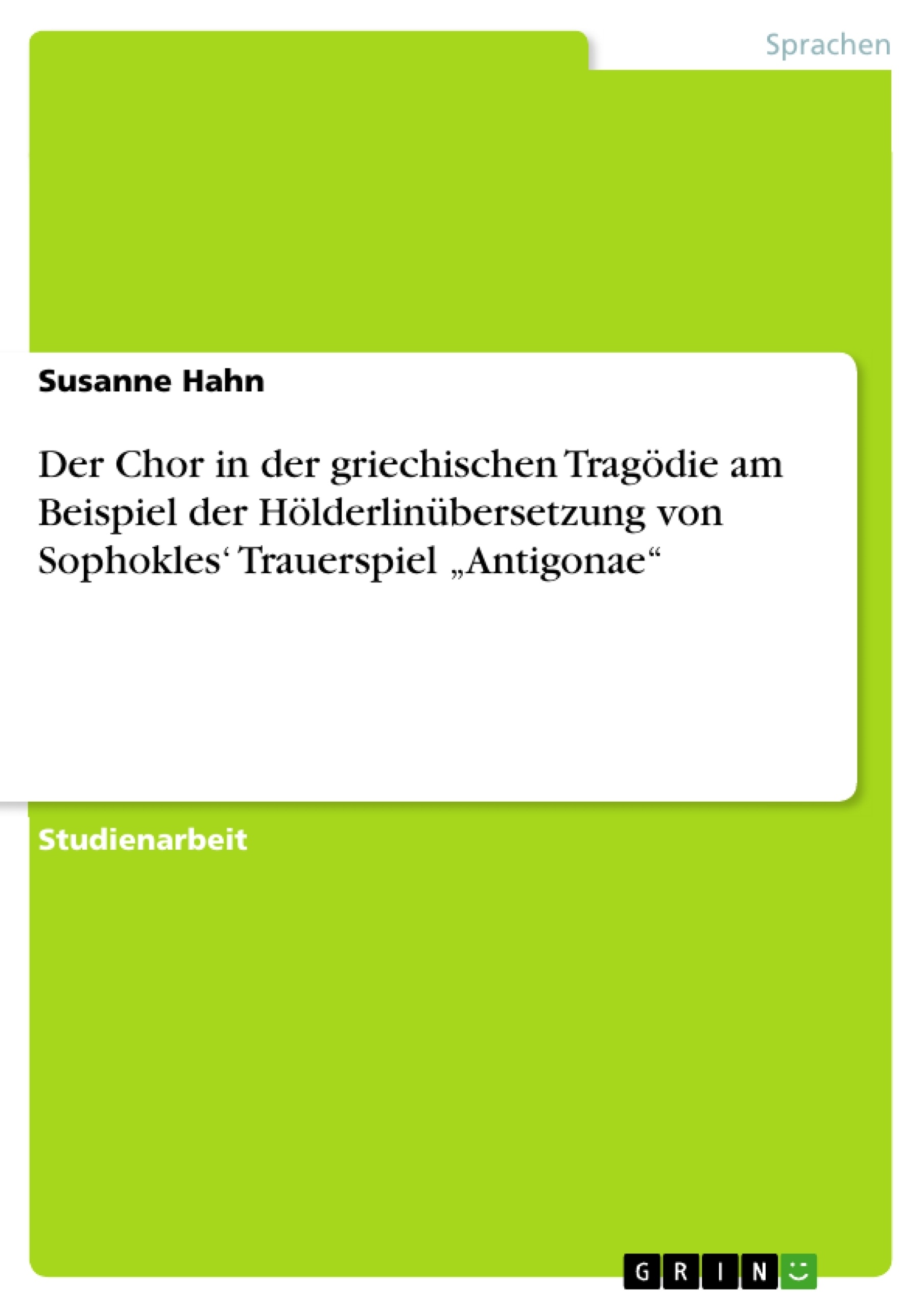In einem Lexikoneintrag zur Rolle des Chors in der griechischen Tragödie heißt es „Der Chor in der alten Tragödie ist ein Vermittelndes, etwas, das die Szene und die Zuschauer zusammenbringt.“ Aus dieser Beschreibung der Aufgabe und Rolle des Chors innerhalb eines Trauerspiels lässt sich schlussfolgern, dass der Chor eine signifikante und unverzichtbare Position innerhalb der griechischen Tragödie einnimmt, da er eine Verbindung zwischen dem Publikum und dem Geschehenen entstehen lässt.
Aber eine Verbindung, wie die eben genannte, entstehen zu lassen ist nicht die einzige Aufgabe des Chors. Welche anderen Aufgaben dem Chor zukommen und in wieweit er seinen Pflichten gerecht wird oder über seine Grenzen hinauswächst, wird innerhalb dieser Arbeit anhand eines der wohl bekanntesten Trauerspiele verdeutlicht: Antigonä von dem im Jahre 496 geborenen und im Jahre 406 verstorbenen griechischen Dichters SophoklesAbb.01. Als „der größte der antiken griechischen Tragödiendichter“ , schrieb er eine Vielzahl von Trauerspielen, so auch seine bekanntesten Antigonä und König Ödipus, die selbst in unserer Gegenwart noch Platz auf den Bühnen der ganzen Welt finden. Schwerpunkt dieser Hausarbeit soll die These sein, dass der Chor in Sophokles‘ ‚Antigonä‘ den generellen Aufgaben des Chores zu jener Zeit entspricht, seinen Anforderungen gerecht wird und unverzichtbar für die Handlung der Tragödie ist. Zunächst einmal muss darauf eingegangen werden, welche Rolle der Chor im Allgemeinen in griechischen Tragödien spielte und welche Aufgaben ihm zuteilwurden, um schlussfolgernd festzustellen, inwieweit Sophokles‘ Chor den Anforderungen entspricht. Wie inszeniert Sophokles den Chor innerhalb seines Stückes und wie stellt er ihn dar? In wie weit würde sich das Stück verändern, wenn der Chor nicht mehr Teil der Tragödie wäre? Würden die Geschehnisse dennoch so eintreffen, wie sie innerhalb des Werkes eintrafen, oder würde sich das Werk grundsätzlich ändern und nicht mehr den Grundzügen eines Typus der griechischen Tragödie entsprechen? Ist schlussfolgernd der Chor aufgrund seiner Aufgaben und Pflichten ein absolut notwendiger Bestandteil des Trauerspieles, sodass ohne ihn das Trauerspiel als solches einstürzen und nicht mehr funktionieren würde, oder würde sich inhaltlich das Trauerspiel nicht verändern?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Chor in der griechischen Tragödie am Beispiel der Hölderlinübersetzung von Sophokles‘ Trauerspiel „Antigonae“
2.1 Der Chor in der griechischen Tragödie
2.2 Sophokles: Antigonae
2.2.1 Die Darstellung und Personifikation des Chors
2.2.2 Die Aufgaben des Chors
2.2.3 Die Signifikanz des Chors und die Veränderungen des Trauerspiels durch dessen Verlust
3. Schlusswort
4. Literatur- und Internetquellenverzeichnis
5. Abbildungsverzeichnis