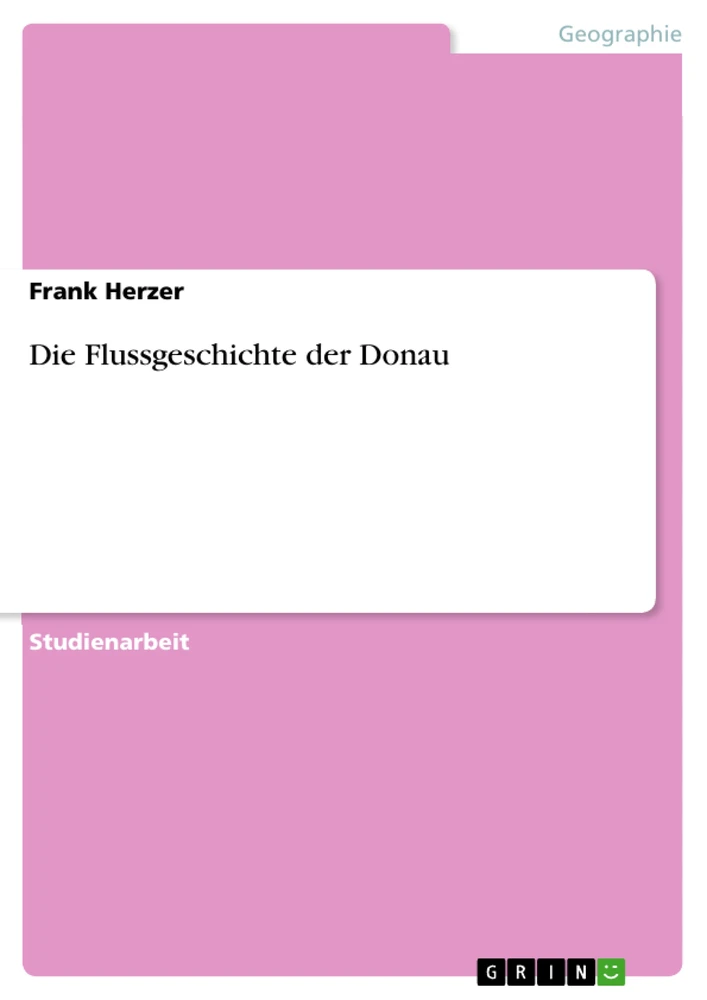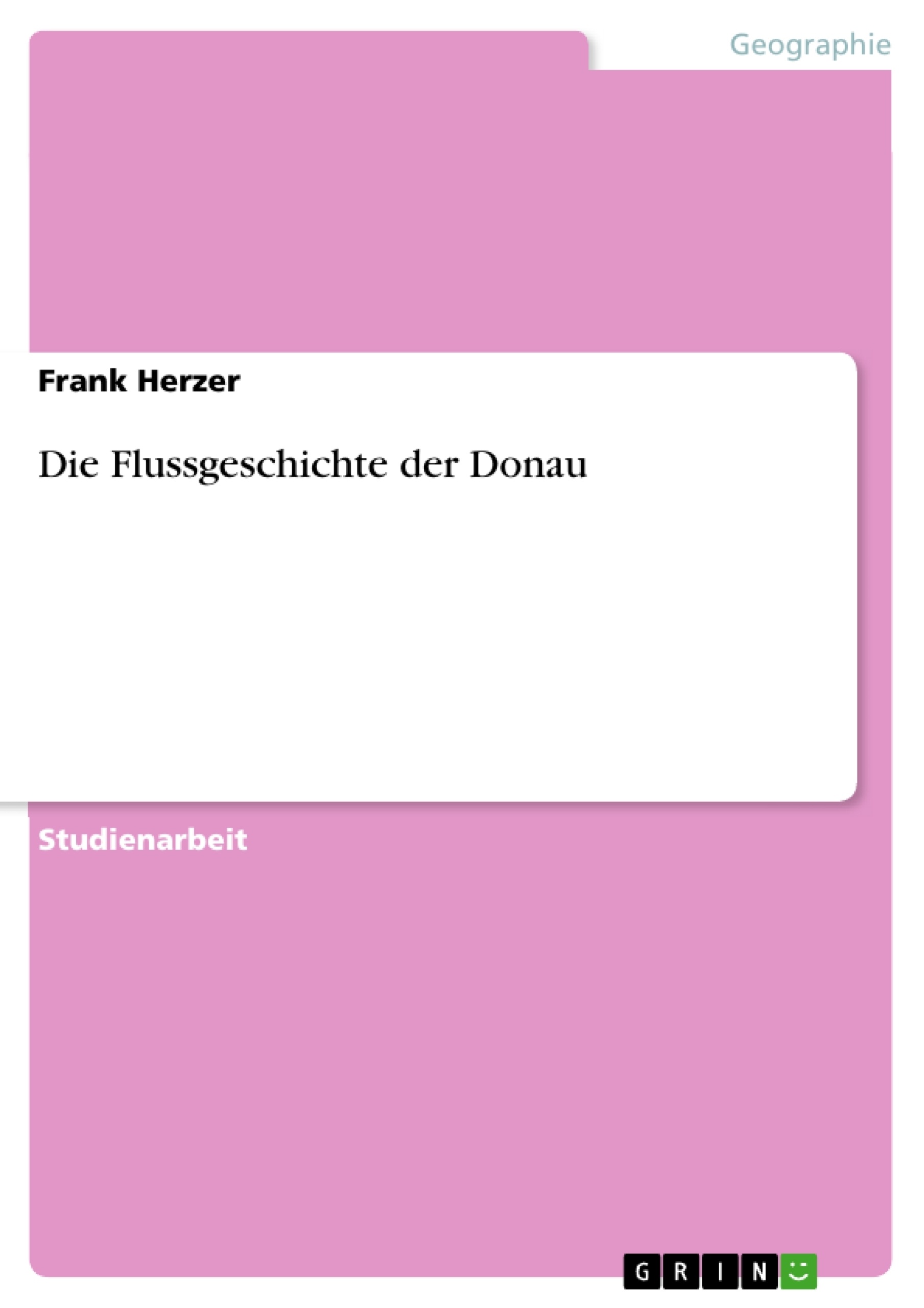Die Donau ist einer der längsten und wasserreichsten Flüsse Europas. Sie hat ein riesiges Einzugsgebiet und entwässert große Teile des südlichen Mitteleuropas und Südosteuropas. An vielen Stellen ist deutlich sichtbar, dass die Donau nicht immer ihr heutiges Flussbett durchfloss, sondern eine ereignisreiche Vergangenheit hat, die ihren Lauf häufig und einschneidend verändert hat.
„Von wann ab können wir in der Erdgeschichte einen Flusslauf nachweisen, welcher im allgemeinen demjenigen entspricht, den wir jetzt Donau nennen?“ (Zenetti, 1919, S. 7) Wie sah dieser aus? Wie hat sich die Donau weiter entwickelt und welche Umstände führten zu den Laufverlegungen? Ich möchte mich in der vorliegenden Arbeit diesen Fragestellungen widmen und dabei den heutigen Erkenntnisstand zum Thema darlegen. Der Schwerpunkt meiner Betrachtung soll auf dem oberen Teil der Donau liegen. In diesem Bereich, der sich hauptsächlich im Alpenvorland Süddeutschlands befindet, fanden die wichtigsten Prozesse und Veränderungen statt, welche die Entstehung der Donau in ihrer heutigen Form geprägt haben.
Nach einigen kurzen Erläuterungen zu Flusslaufentwicklungen im Allgemeinen werde ich, ausgehend vom gegenwärtigen Verlauf, die Flussgeschichte seit dem oberen Miozän darstellen. Ich gebe einen kurzen Überblick zum heutigen Forschungsstand, bevor ich auf die Entstehung und das Gewässersystem der Urdonau eingehe. Danach betrachte ich speziell die Geschichte des oberen und kurz die Geschichte des mittleren und unteren Flussabschnitts. Abschließend werde ich kurz den Einfluss des Menschen auf den Flusslauf aufzeigen und meine Ausführungen in den Schlussbemerkungen noch einmal zusammenfassen.
Die Flussgeschichte der Donau fand in einem ausgedehnten Zeitraum statt. Zum Zwecke der Verdeutlichung befindet sich im Anhang eine Zeittafel. Dort sind die wichtigsten Abschnitte der Entwicklung noch einmal geordnet dargestellt. Mit dieser Hilfe kann man die im Text verwendeten Angaben zeitlich besser einordnen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungen
1 Einleitung
2 Flusslaufentwicklung im Überblick
2.1 Flussterrassen
3 Heutiger Flussverlauf
4 Flusslaufentwicklung der oberen Donau
4.1 Entstehung der Urdonau
4.2 Gewässersystem der Urdonau
4.3 Flusslaufverlegungen
4.3.1 Aaredonau
4.3.2 Alpenrhein
4.3.4 Flussanzapfung durch die Wutach
4.3.5 Ausblick
5 Entwicklung des mittleren und unterem Flusslaufes
6 Einfluss des Menschen
7 Schlussbemerkungen
Internetquellen
Literaturverzeichnis
Anhang