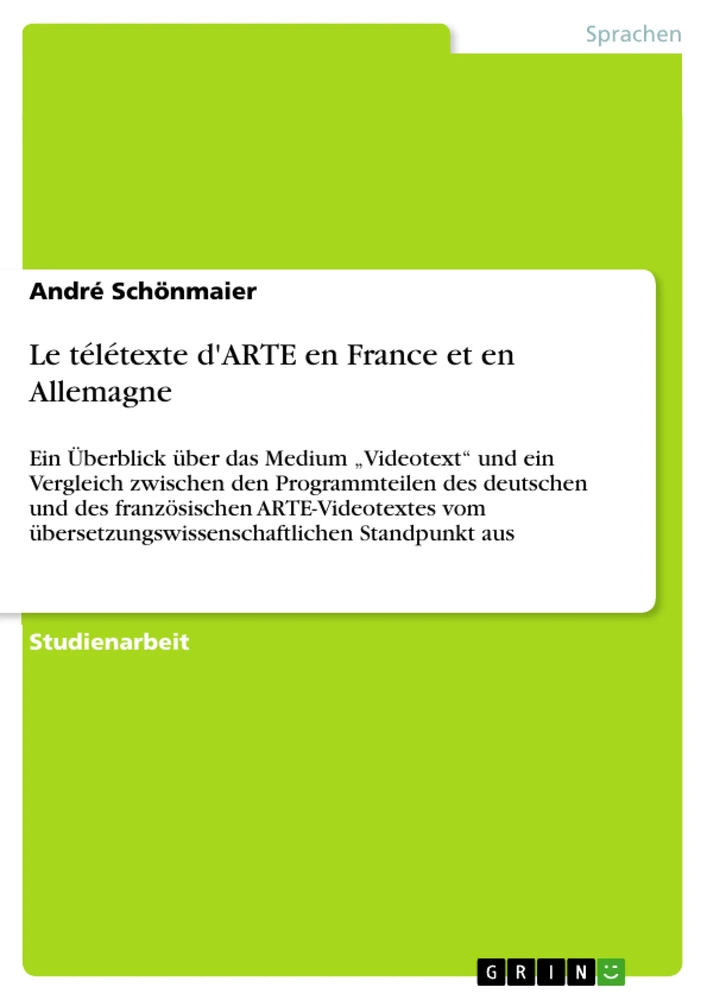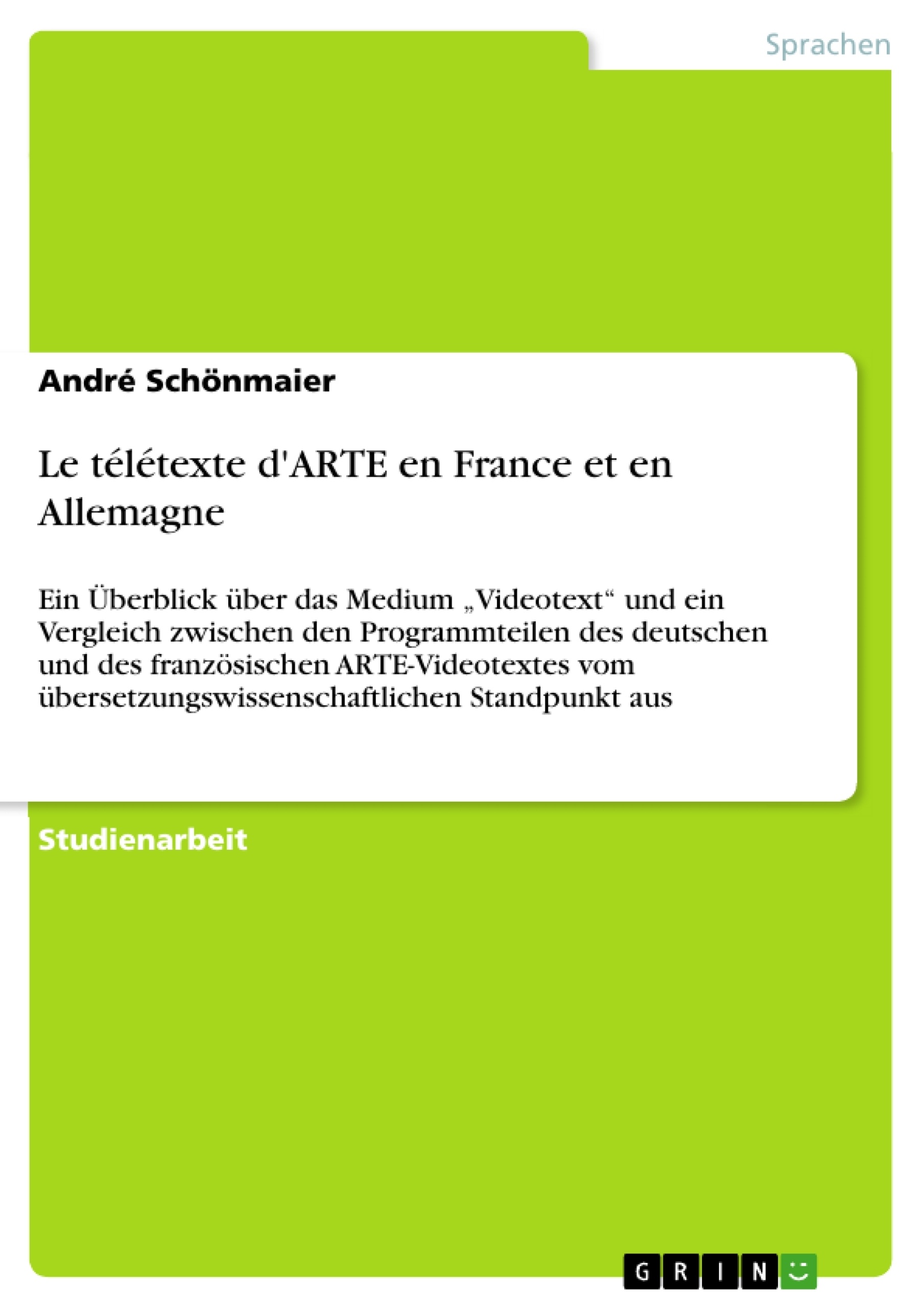Videotext ist kein Text im eigentlichen Sinne. Er enthält Informationen, Dienste und Unterhaltungselemente. Der ARTE-Videotext richtet sich insbesondere an seine Zuschauer. Er bietet abgesehen von politischen und kulturellen Nachrichten sowie internen Informationen viele Informationen zum ARTE-Programm. Zwei Programmtage (heute und morgen) werden detailliert vorgestellt (Programmtabellen plus Beschreibungen), die restlichen sieben kommenden Programmtage werden nur in Form von Tabellen präsentiert. Dies gilt sowohl für den französischen wie den deutschen Videotext.
Deshalb werden in dieser Arbeit nach der Darstellung der über 30-jährigen Geschichte des Mediums „Videotext“ und seiner Rolle in der Medienwelt die Unterschiede zwischen den Videotexten von ARTE Frankreich und ARTE Deutschland besprochen. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sich die Videotexte von ARTE in etlichen Aspekten unterscheiden, die Programmbeschreibungen von der „kulturellen Nähe“ bestimmt werden und Videotextredaktion eine Art übersetzerische Tätigkeit ist.
Inhaltsverzeichnis
0. Abrégé
1. Einleitendes
1.1. Begründung der Themenwahl
1.2. Forschungsstand.
1.3. Sprachregelung
1.4. Untersuchungsgegenstand.
2. Allgemeines zum Thema Videotext
2.1. Definition
2.2. Geschichte des Videotextes in Deutschland undFrankreich im Vergleich
2.3. Funktionen des Videotextes und seine Nutzer
2.4. Konventionen
3. Der ARTE-Teletext
4. Angewandter Textvergleich
4.1. Einleitende Anmerkungen zum Vorgehen und Datenmaterial
4.2. Struktur
4.3. Themenauswahl
4.4. Konventionen
4.5. Präsuppositionen
4.6. Zusammenstellungder Unterschiede
5. Fazit und offene Fragen
6. Bibliographie