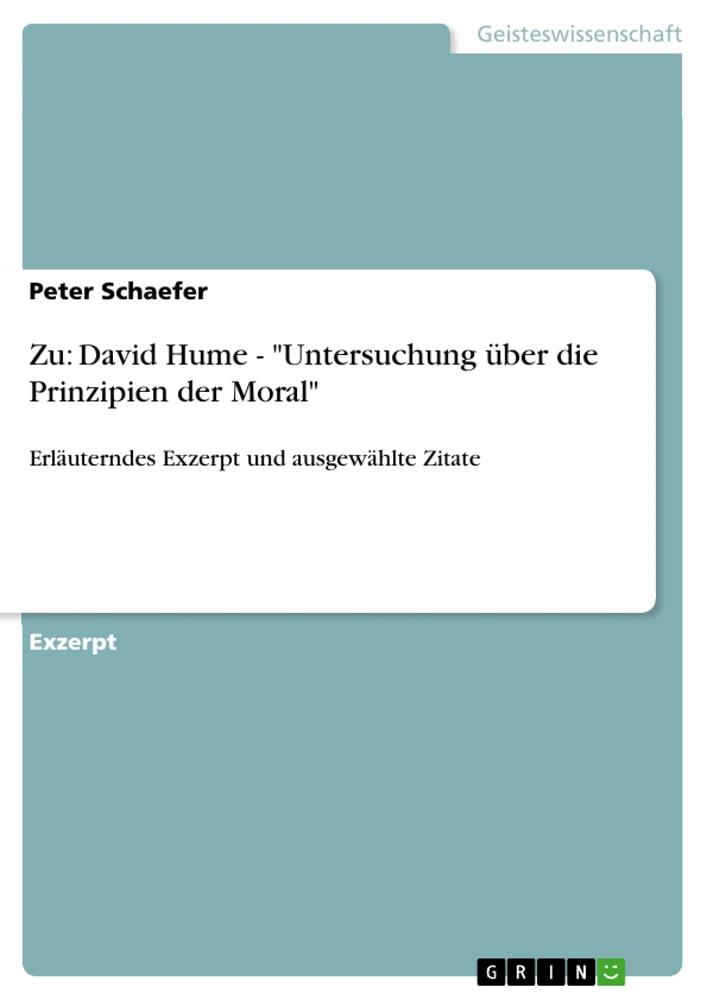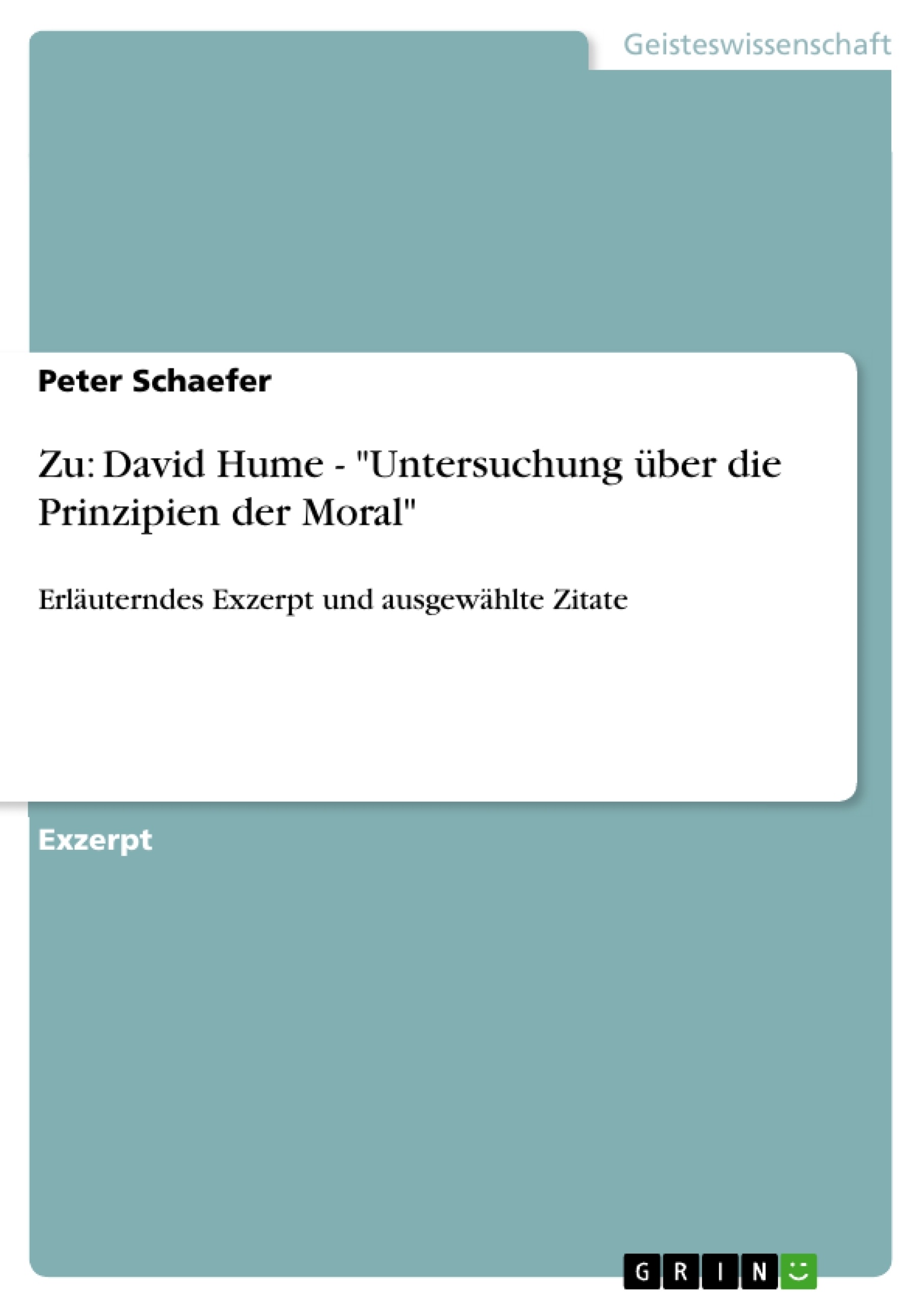Das vorliegende Exzerpt folgt e i n e r zentralen Absicht: Die wichtigsten Passagen des Werkes von DAVID HUME unter besonderer Berücksichtigung einer bestimmten Fragestellung zu zitieren. Angedacht ist das Exzerpt als Arbeitsgrundlage, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen und in komprimierter Form die wesentlichen Gedanken HUMES nachvollziehen zu können.
Es wurde versucht, die Inhalte unter folgender zentraler Fragestellung auszuwählen:
Wie sieht HUMES Methode aus, moralisch zu argumentieren?
Will man versuchen, diese Fragestellung kurz und knapp zu beantworten, könnte man sagen, dass HUME eine Ethik mit humanistischem Anspruch beschreibt, die empirisch und anthropologisch fundiert scheint. Andererseits wäre diese Antwort zu knapp und unzureichend, um sie als solche allein bestehen zu lassen – Tatsächlich ist diese Frage sehr viel differenzierter zu betrachten und in Folge dessen auch sehr viel komplizierter zu beantworten. Dies begründet sich nicht zuletzt durch HUMES wissenschaftlich sehr fundierte, aber auch umfassende Methode, die Moral zu erforschen.
Er scheint sich zwar zunächst auf sehr grundlegende Beobachtungen menschlichen Verhaltens zu konzentrieren, liefert im Fortschritt des Werks jedoch immer mehr historische und soziokulturelle Belege für seine Thesen, welche wiederum Anstoß für neue, tiefergehende Nachforschungen sein können.
Tatsächlich bringt HUME in seinem Werk in einigen Exkursen eine Vielzahl an Informationen zu zahlreichen Themengebieten, deren vollständiges exzerpieren den Rahmen dieses Exzerpts sprengen würde und nur unter großem Mehraufwand hinsichtlich der Strukturierung dieser Arbeit möglich wäre. Damit wäre man zwar dem Anspruch einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung gerecht geworden, hätte das eigentliche Ziel aber verfehlt, denn dieses Exzerpt kann, will und soll keine wissenschaftliche Abhandlung sein und will folglich auch nicht als solche verstanden werden. Wer sich jedoch mit HUMES Methode, moralisch zu argumentieren oder anderen die Ethik betreffenden Fragestellungen auseinandersetzt, kann in diesem Exzerpt hierzu einige wichtige, hilfreiche und gefilterte Informationen finden.
Inhalt
Prolog
Einleitung
Inhaltliches zur Untersuchung
Über die allgemeinen Prinzipien der Moral
Über das Wohlwollen
Über die staatliche Gesellschaft
Warum die Nützlichkeit gefällt
Über Eigenschaften, die uns selbst nützlich sind
Über Eigenschaften, die anderen unmittelbar angenehm sind
Schluß
Schluß - Humes Kritik an der Theorie des Egoismus
Humes Kritik am Rationalismus
Humes Moralphilosophie – Objektivistisch? Subjektivistisch? Intersubjektivistisch?
Ausgewählte Zitate
Erster Abschnitt (Über die allgemeinen Prinzipien der Moral)
Zweiter Abschnitt (Über das Wohlwollen)
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Abschnitt (Über die Gerechtigkeit)
Erster Teil
Zweiter Teil
Vierter Abschnitt (Über die staatliche Gesellschaft)
Fünfter Abschnitt (Warum die Nützlichkeit gefällt)
Erster Teil
Zweiter Teil
Sechster Abschnitt (Über Eigenschaften, die uns selbst nützlich sind)
Erster Teil
Zweiter Teil
Siebter Abschnitt (Über Eigenschaften, die uns selbst unmittelbar angenehm sind)
Achter Abschnitt (Über Eigenschaften, die anderen unmittelbar angenehm sind)
Neunter Abschnitt (Schluß)
Erster Teil
Zweiter Teil
Anhang I (Über das moralische Gefühl)
Anhang II (Über die Selbstliebe)
Anhang III (Einige weitere Überlegungen zur Frage der Gerechtigkeit)
Anhang IV (Über einige Wortstreitigkeiten)
Ein Dialog
Index