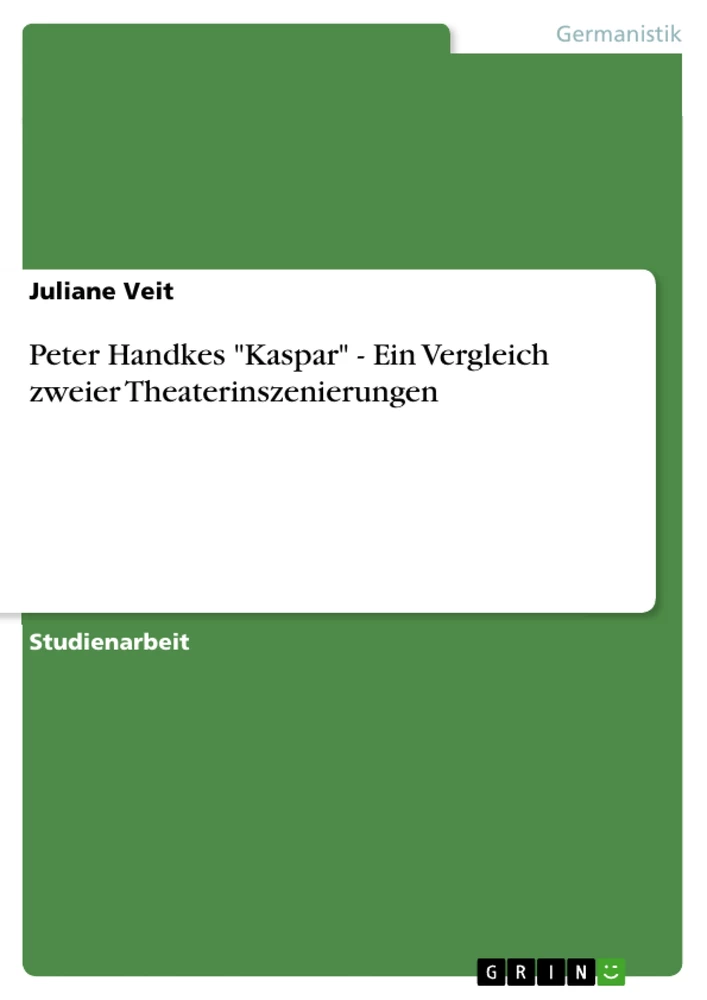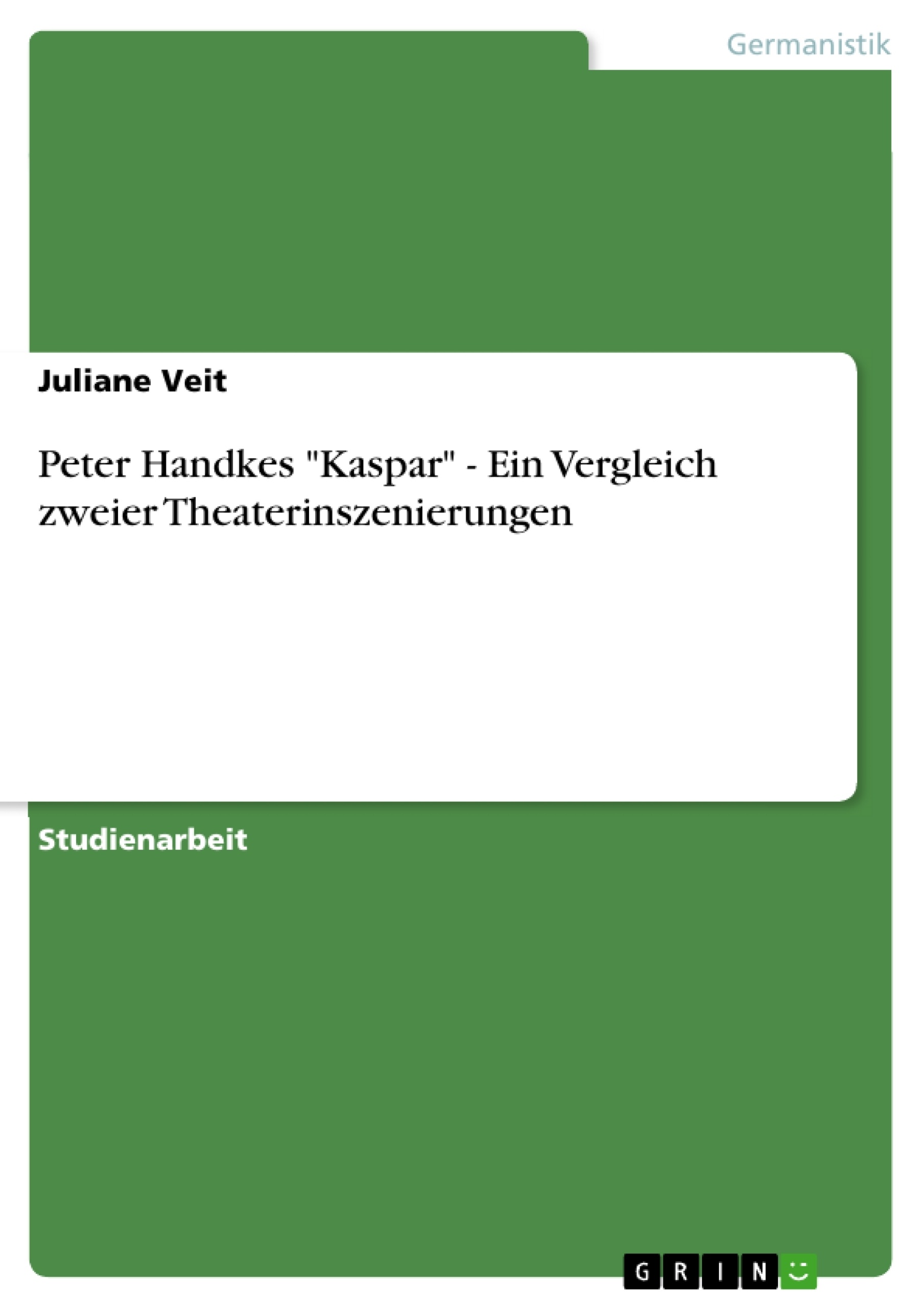Peter Handke wurde 1942 in Österreich geboren. 1966 veröffentlichte er seinen ersten großen Erfolg „Publikumsbeschimpfung – ein Sprechstück“. Aufgrund der in diesem Stück „auswuchernden Sprachklischees“ übersieht man fast die darin enthaltene Sprachkritik. Deutlicher wird diese in seinem späteren Werk „Kaspar“, das 1968 uraufgeführt wurde. Zugrunde legt Handke diesem den Kaspar-Hauser-Stoff, allerdings ohne sich inhaltlich wirklich darauf zu beziehen: „Das Stück „Kaspar“ zeigt nicht, wie es wirklich ist oder wirklich war mit Kaspar Hauser.“. Der Österreicher legt sein Augenmerk vielmehr auf das Verhältnis Kaspars zur Sprache, also auf die Entwicklung von Sprachlosigkeit hin zur Sprache und die damit verbundene Manipulierbarkeit des Individuums. Da Kapar die Sprache aufgedrängt wird, ist der Untertitel „Sprechfolterung“ durchaus berechtigt und inhaltlich passend. Im Gegensatz zur vordergründigen Provokation der Zuschauer in der „Publikums-beschimpfung“ tritt in „Kaspar“ die offensichtliche Sprachkritik in den Vordergrund, so dass die Zuschauer ihre Augen nicht mehr davor verschließen können. Diese Sprachkritik weitet sich in „Kaspar“ zu einer ganzen Gesell-schaftskritik aus, die für die Literatur und das Theater der 60er Jahre typisch ist. Sprache macht den Menschen zum Menschen, so Handkes Auffassung. Legt man dieses Zitat zugrunde, wird deutlich, dass die Beschäftigung mit Sprache im Allgemeinen und gerade die Beziehung von Sprache zum Menschen sehr wichtig ist für den 1942 geborenen Autor. „Kaspar“ ist somit ein Werk der „[...] Menschwerdung durch Sprachfindung [...]“.
Im Folgenden werde ich zwei Inszenierungen von Handkes „Kaspar“ miteinander vergleichen: die Bonner Aufführung von Alexander Riemenschneider aus dem Jahr 2010 mit der bereits 1987 entstandenen und seither unveränderten Inszenierung von Roberto Ciulli vom Theater an der Ruhr in Mülheim.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vergleich
2.1 Das Bühnenbild
2.2 Die Requisiten
2.3 Die Figuren
2.4 Die Kostüme
2.5 Das Regiekonzept
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis