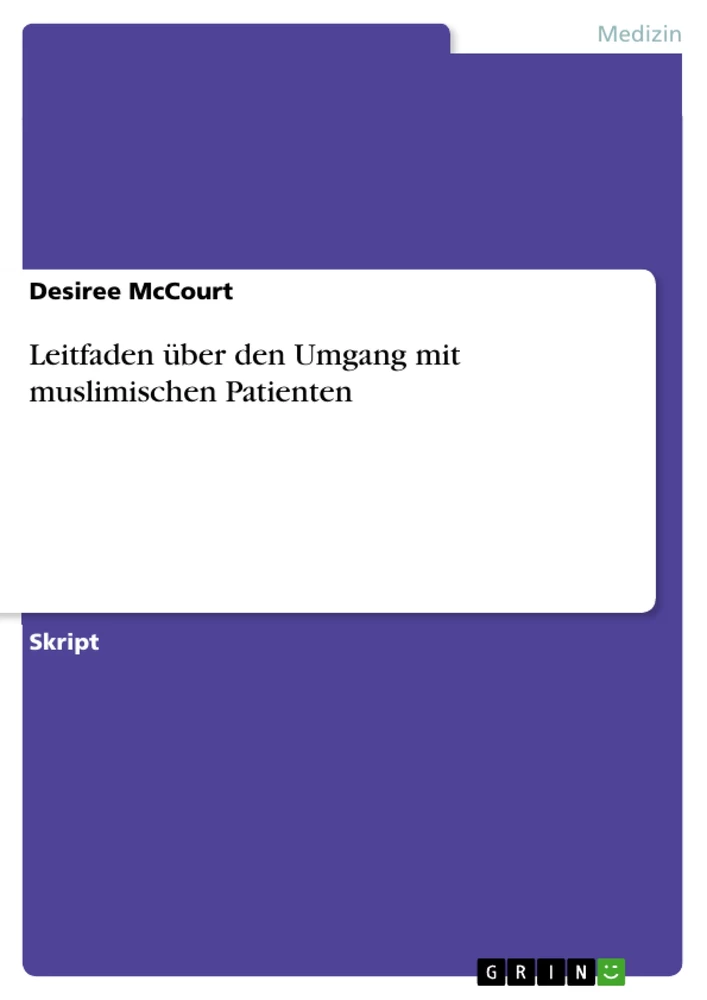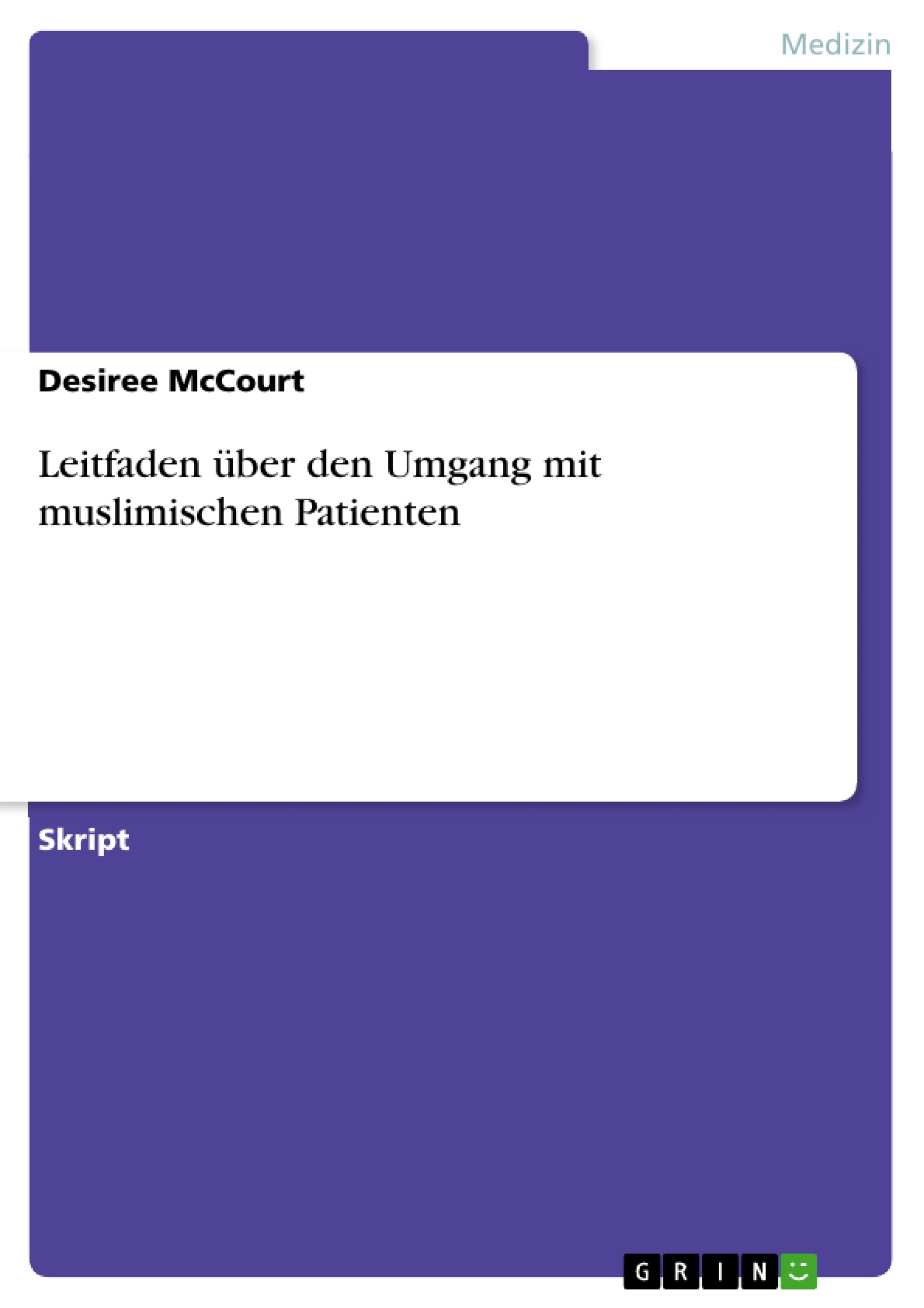Die Betreuung muslimischer Patienten gehört spätestens seit der Anwerbung ausländischer Mitarbeiter vor über 40 Jahren bei uns zum Alltag. Für viele muslimische Patienten ist der Gang zum Arzt oder in ein Krankenhaus eine große Belastung. Ursachen sind hauptsächlich Sprachprobleme, gefühlte Isolation der Migranten, das andere Geschlecht des Behandelnden, Nahrungsvorschriften und nicht zuletzt das Gefühl, dass ihre Religion und Sichtweisen als minderwertig angesehen werden.
Das vorliegende Handout ist das schriftliche Material für Teilnehmer meiner Kurse „Umgang mit muslimischen Patienten“. Ich selbst bin keine Muslima, und keine Medizinerin. Ich habe Islamwissenschaft studiert und habe beruflich und privat im arabischen Raum gelebt. Meine derzeitige Tätigkeit führt mich jährlich zwei bis dreimal in die Region und so habe ich bis heute Ärzte und Krankenhäuser in fast allen arabischen Ländern kennengelernt. Ich war in teuren privat Kliniken und habe Wunderheilerinnen in Städten und Dörfern kennengelernt. Also praktische Erfahrungen in vielen Facetten gemacht.
Ich möchte zu bedenken geben, dass der Islam und die Muslime verwirrend vielfältig sind. So vielfältig, wie es eine Vielzahl muslimischer Gesellschaften in dem 57 Mitgliedsstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz gibt. Eine kopftuchtragende Patienten oder ein barttragender Pflegebedürftiger sind keine zuverlässigen Parameter für die muslimische Zuordnung. Nicht alle Muslime befolgen streng religiöse Gebote und Verbote. Dieses Handout ist für medizinisches und ärztliches Personal im deutschsprachigen Raum gedacht, dass mit muslimischen Patienten konfrontiert ist.
Es werden fast alle Themen behandelt; Geburt, Anamnese, Pflege, Therapie und Tod. Dieses Handout soll das Verständnis für die Bedürfnisse der Patienten erwecken und das „Warum“ der Bedürfnisse erklären.
Als Pflegende und Behandelnde sind Sie den alltäglichen großen Belastungen ausgesetzt. Dieses Handout soll in Ihnen ein Verständnis für die Muslime geben. Damit sie Ihr gemeinsames Ziel, die schnelle Genesung gemeinsam meistern und erleichtern können.
Der erste Teil des Handouts behandelt grundsätzliches zum Kulturbegriff, als nächstes das Thema Islam und dem Thema Medizin im Islam. Gefolgt von Hinweisen zum Umgang mit muslimischen Patienten. Am Ende ist zur schnellen Übersicht eine „Checkliste angefügt“.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Kulturbegriff
1a moderner Kulturbegriff
1b Die Kulturzwiebel
1c Kulturkonflikte
2 Migration in Deutschland
3 Islam
3a Der Prophet Mohammed
3b Der Glaube der Muslime
3c Fünf Säulen des Islam
3d Woran Glauben Muslime im Islam?
3e Der Koran (Qur’an)
4 Die Geschichte der Medizin im Islam
4a Blütezeit der islamischen Medizin
4b Die medizinischen Leistungen
Tipps für den Umgang mit muslimischen Patienten im Alltag
5 Pflichtgebet im Krankenhausalltag
6 Ramadan im Krankenhausalltag
7 Diäten
8 Die Beziehungen zwischen Arzt und Patient
9 Die Erwartungen an das Pflegepersonal
10 Krankheit und Volksglauben (Djin und Satan)
11 Untersuchung des Patienten
12 „Morbus Bosporus“ - Schmerzäußerungen
13 Das Diagnosegespräch
14 Angehörige im Krankenhaus
15 Zur Frau
16 Sterben und Tod
17 Checkliste
18 Literaturverzeichnis