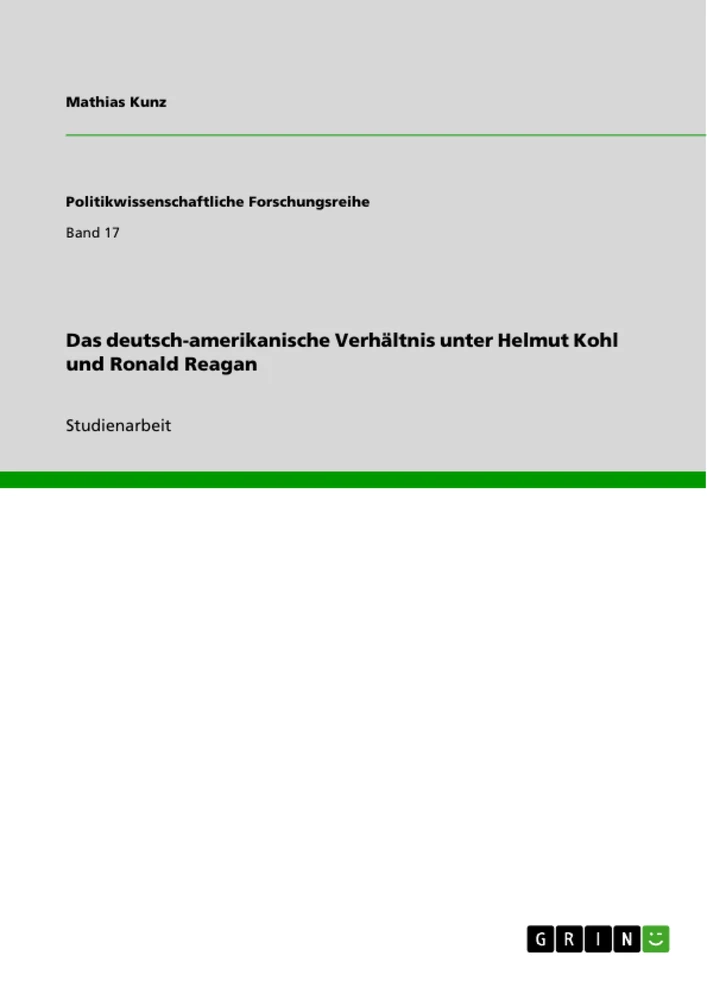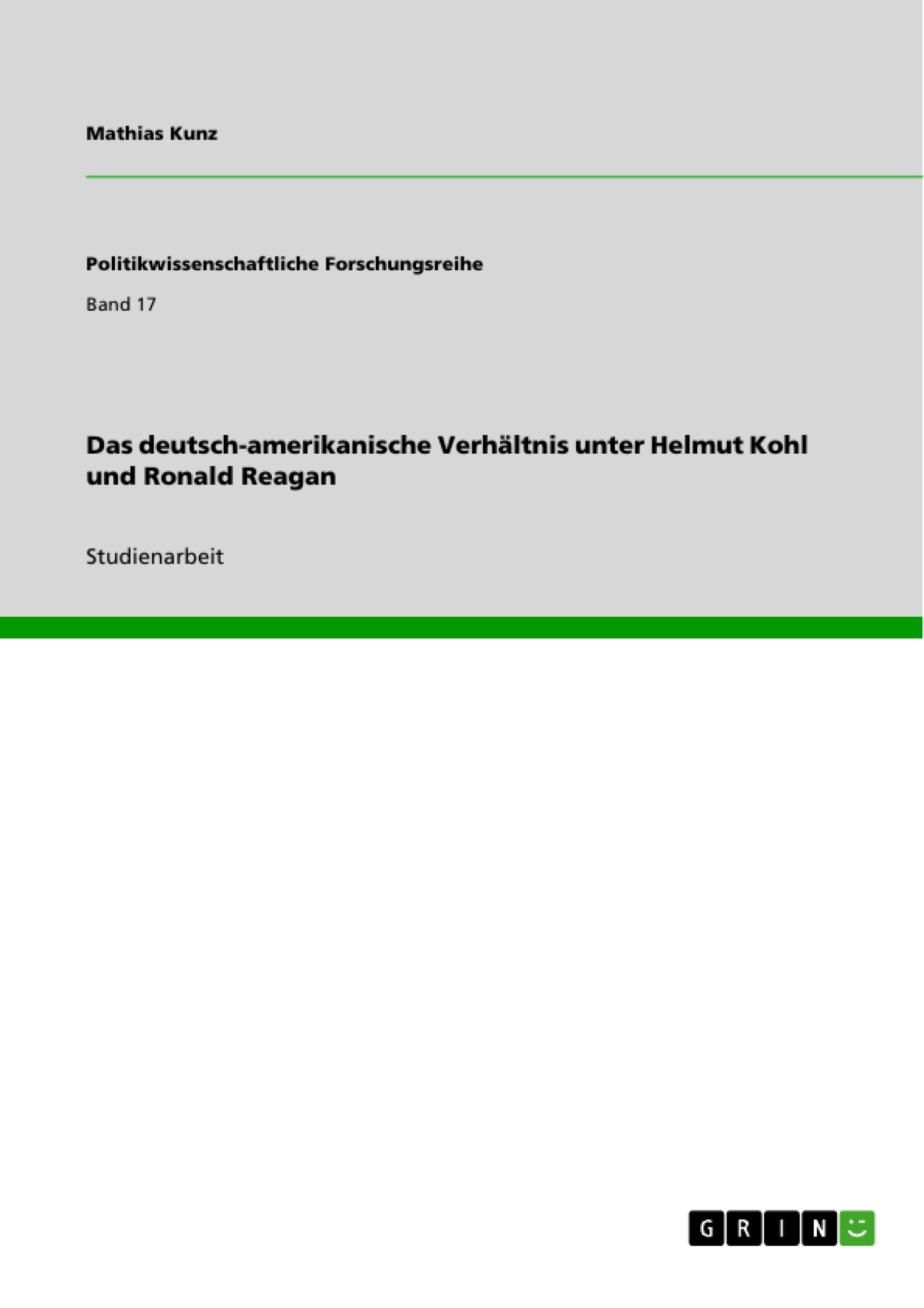Traditionell besteht zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und der Bundesrepublik Deutschland ein sehr enges und vertrautes Verhältnis, was auf die Gründungsphase der Bundesrepublik zurückzuführen sein dürfte, da in dieser Zeit die USA maßgeblich am Aufbau der noch jungen demokratischen bundesdeutschen Ordnung beteiligt waren. Dieses enge und vertrauensvolle Bündnis begann jedoch Ende der 1970er Jahre zu bröckeln, als die Frage aufkam, ob die Bundesrepublik auch weiterhin ein verlässlicher Partner im Kalten Krieg wäre. So titelten beispielsweise einflussreiche Zeitungen zu Beginn der 1980er Jahre „Can U.S. still count on West Germany?“ , „Bonn and Washington: From Deterioration to Crisis?“ oder auch „Two Allies in Trouble“ .
Doch waren die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu Beginn der 1980er Jahre und während dessen Verlauf tatsächlich derart kritisch zu bewerten?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Erbe Helmut Schmidts
3. Der erste Besuch Helmut Kohls in Washington als Bundeskanzler
4. Das Treffen in Bitburg
5. Zusammenfassung
Quellen- und Literaturverzeichnis