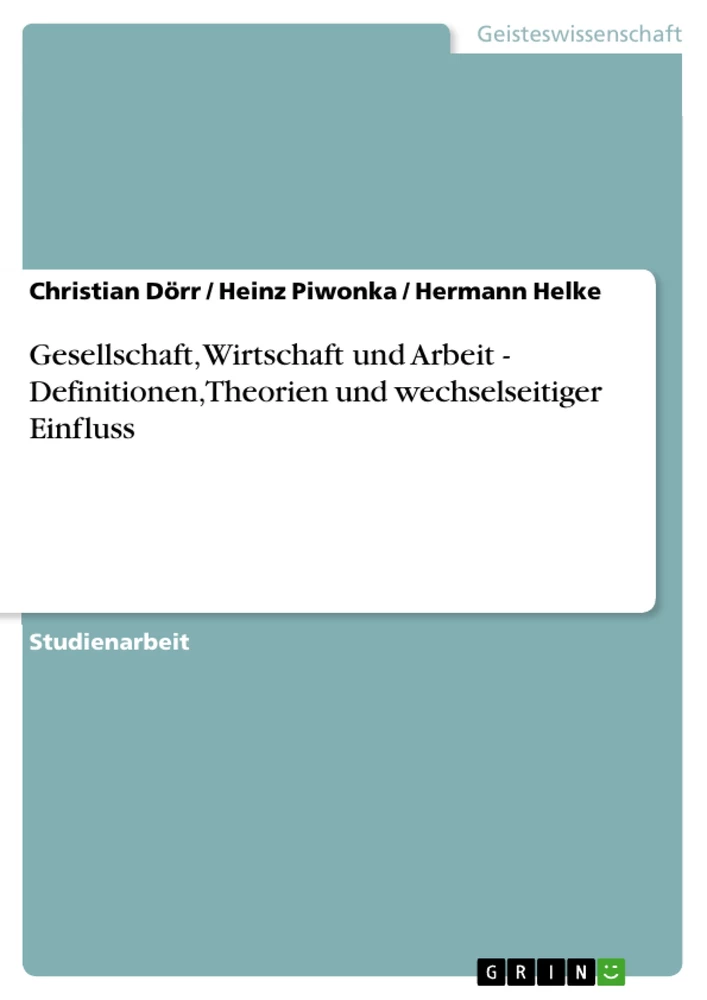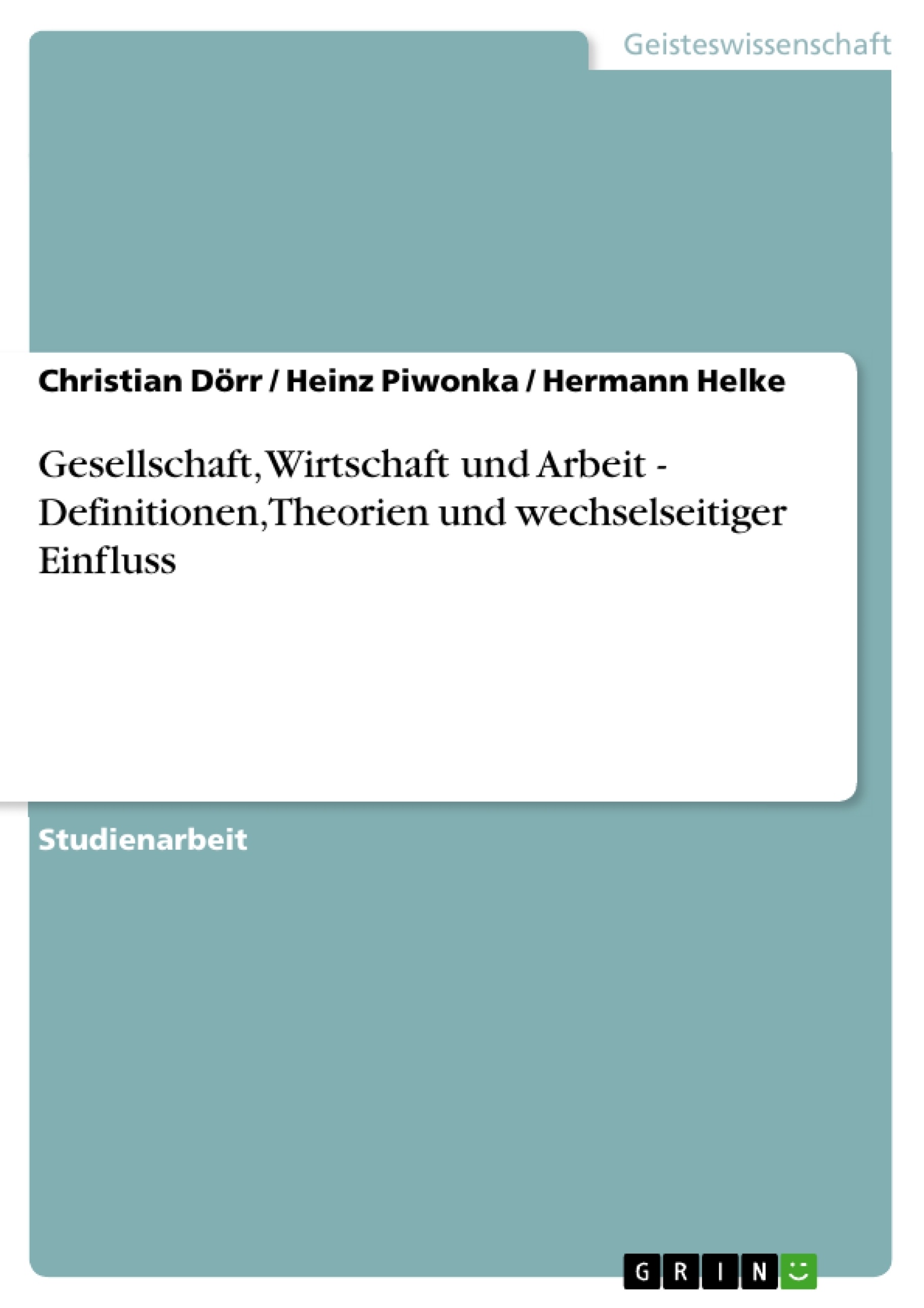Die Themen Wirtschaft und Arbeit sind in allen möglichen gesellschaftlichen
Lebensbereichen anzutreffen bzw. haben Auswirkungen auf diese und sind daher wesentliche
Paradigmen der sozialwissenschaftlichen Forschung. Die Wirtschaft beschäftigt sich mit der
Produktion, dem Verkaufsprozess und der Distribution von Gütern, sowie Dienstleistungen.
Ziel ist es die Bedürfnisse von Kunden zu befriedigen und dabei im – Allgemeinen – einen
Gewinn zu erzielen. Dazu bedient sich die Wirtschaft verschiedener Märkte (z. B.
Kapitalmarkt, Immobilienmarkt, Textilmarkt, Automarkt, etc.). Das Verrichten einer Tätigkeit
wird Arbeit genannt. Menschen benötigen, um ihre materiellen Wünsche und Bedürfnisse zu
befriedigen, Tauschmittel, die gegen die begehrten Waren eingetauscht werden können. Um
in den Besitz dieser Tauschmittel zu gelangen, bedienen sich Menschen u. a. der Arbeit.
Dabei bieten sie ihre physischen und psychischen Fähigkeiten anderen gegen Entlohnung an,
d. h. sie bieten ihre Arbeitskraft am Markt an und nehmen so am wirtschaftlichen Leben teil.
Nachdem die menschliche Arbeitskraft besondere Aspekte aufweist, wird auch der ihr
zugehörige Markt – der Arbeitsmarkt – einer speziellen Betrachtung unterzogen werden
müssen. Viele Faktoren haben massiven Einfluss auf Wirtschaft und Arbeit, manchmal erst
auf den zweiten Blick. Welche Auswirkungen hat z. B. ein Vulkanausbruch auf Island für die
europäische und internationale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt? Auf den ersten Blick könnte
man meinen, dass hier keine direkten Zusammenhänge ersichtlich sind, doch dieser Eindruck
täuscht. Aktuell zeigt der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull seit 21. März
2010 die Verbindungen zwischen Naturkatastrophen und den nationalen und internationalen
Wirtschafts- und Arbeitsmärkten auf. Nebenbei sei bemerkt, dass was die Menschen als
Naturkatastrophen beklagen, strictu sensu als Sozial- bzw. Kulturkatastrophen angesehen
werden müssen. Natürliche Vorgänge verwandeln sich dort zur Katastrophe, wo sie die
sozialen und kulturellen Zusammenhänge der Gesellschaft in Gestalt von Schäden tangieren
(vgl. Kröll 2009, S. 79f). Wegen des Vulkanausbruchs kam es zu schweren Behinderungen
des Luftverkehrs in Europa und in aller Welt. International wurden bisher fast 100.000 Flüge
gestrichen. Millionen Menschen saßen auf Flughäfen fest und konnten ihre Zeitpläne und
terminlichen Verpflichtungen nicht einhalten, was [...]
Inhalt:
1 Einleitung (Heinz Piwonka)
2 Wirtschaft (Heinz Piwonka)
2.1 Definitionen
2.2 Historie
2.3 Wirtschaftstheorie
2.3.1 Adam Smith (1723 - 1790)
2.3.2 Karl Marx (1818 - 1883)
2.3.3 Karl Polanyi (1886 - 1964)
2.4 Einflüsse der Religion auf die Wirtschaft
2.5 Legitimität der kapitalistischen Ökonomie
3 Arbeit & sein Antagonist (Hermann Helke)
3.1 Institutionalisierung der Arbeitsmärkte
3.2 Strukturwandel im 19. und 20. Jahrhundert, vom Agrarstaat zur Informationsgesellschaft
3.3 Auswirkungen des Strukturwandels auf die Arbeitsmärkte 10 Arbeit:
Arbeitsverhältnisse (Prekariat):
Steueraufkommen und Staatsfinanzen:
3.4 Arbeitslosigkeit = AL (vgl. Beckert 2007)
Definition
Typen der AL
3.5 Theorien zur Dynamik von Arbeitsmärkten
4 Reziprozitäten Wirtschaft-Arbeit (Christian Dörr)
4.1 Tertiarisierung der modernen Gesellschaft:
4.2 Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft:
4.3 Umgang mit Arbeitslosigkeit (Was tun gegen Arbeitslosigkeit?) ...
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis